Die korrekte Provinzbezeichnung des 1. Jahrhunderts, Raetia et Vindelica,
drückt bereits aus, dass es sich um kein einheitliches, von einer dominierenden
vorrömischen Bevölkerung geprägtes Gebiet handelt, sondern um eine künstlich
von Rom geschaffene Verwaltungseinheit. Naturräumlich zerfällt Rätien in drei
Zonen: die Zentralalpen, das Voralpengebiet mit seinen Schotterebenen bis zur
Donau und das von dem Mittelgebirge der Schwäbischen und Fränkischen Alb geprägte
„Limesgebiet“. Diese geographischen Einheiten entsprechen auch den Etappen der
Eroberung bzw. Besetzung des zwischen 15 v. Chr. und 160 n. Chr. nordwärts ausgedehnten
Provinzterritoriums. Während im Süden das Gebiet um den Lago Maggiore von vornherein
mehr oder weniger direkten Anschluss an die Entwicklung Oberitaliens hatte,
ist das Limesgebiet ab ca. 100 n. Chr. offenbar weitgehend mit Hilfstruppenveteranen
aufgesiedelt worden. Vier bis fünf Generationen Bestandsdauer waren offenbar
zu wenig Zeit für die dortige „Militär-romanisierte“ Bevölkerung, um eine unverwechselbare,
eigenständige provinzialrömische Kultur zu entwickeln. In welchem Umfang im
Voralpenland um Christi Geburt noch einheimisch-spätlatènezeitliche Bevölkerung
siedelte, ist nach wie vor umstritten. Die Geschichtsschreibung überliefert
die Stammesnamen der Brigantier, Estionen und Likatier als Teile der Vindeliker
(Dietz 2004). Durch ein verbessertes Verständnis der spärlichen bzw. schwer
deutbaren archäologischen Quellen mehren sich Indizien für eine autochthone,
vindelikische Bevölkerung (Zanier 2004). Deren offenbar eigenwillige Bestattungssitten
haben kaum archäologischen Niederschlag gefunden: es fehlen nicht nur Grabbauten
jeglicher Art, sondern meist die Gräber überhaupt. Vor wie nach der römischen
Okkupation ist auch mit Einwanderungen noch unbekannten Ausmaßes zu rechnen.
Beigaben der wenigen in das 1. Jahrhundert v. Chr. datierbaren Gräber weisen
etwa auf Verbindungen mit Mitteldeutschland hin.
Für Rom lag die Bedeutung Rätiens in seiner verkehrsgeographischen Lage. Diente
der Alpenfeldzug des Augustus in erster Linie der Sicherheit Oberitaliens und
der Kontrolle der Alpenpässe, so galt die weitere Nordverschiebung der Militärgrenze
vorwiegend dem Ausbau der West-Ost-Verbindungen zwischen den Rhein- und Donauarmeen.
Gerade bei Betrachtung der Grabbau-Kultur zeigen sich Orientierungen bzw. Beeinflussen
nach bzw. aus dem Westen, dem Osten oder Süden, jedoch wenig eigenständige Entwicklung.
In der Grenzprovinz Rätien war fast 200 Jahre lang keine Legion – bzw. anfänglich
nur Teile einer solchen – stationiert, deren Veteranen schon frühzeitig eine
finanzkräftige und kulturtragende provinziale Führungsschicht hätten bilden
können, wie dies in Ober- und Niedergermanien der Fall war. Mehr vielleicht
als die meisten anderen Grenzprovinzen blieb die kulturelle Entwicklung Rätiens
von staatlichen „Subventionen“ abhängig. Die Kontraste fallen besonders markant
aus, wenn man Raetia mit der östlich angrenzenden Provinz Noricum vergleicht.
In den etwa gleichgroßen Territorien und dem gemeinsamen Verwaltungskonzept
einer prokuratorischen Provinz (bis um ca. 170 n. Chr.) erschöpfen sich bereits
die Gemeinsamkeiten der beiden Nachbarn. In kultureller Hinsicht könnten die
Unterschiede kaum größer sein.
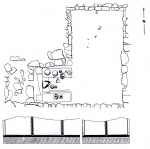 Genau
genommen handelt es sich im Erhaltungszustand des archäologischen Befundes um
Grabeinbauten in Gestalt teils gemauerter teils aus schweren Steinplatten errichteter
Grabkammern. Diese Merkmale treffen auf eine kleine, exklusive Gruppe reich ausgestatteter
Gräber innerhalb der Nekropole von Minusio-Cadra zu, von der insgesamt 33 Gräber
freigelegt wurden. Der Friedhof lag an einem exponierten Hang oberhalb von Locarno,
dem Hauptort der civitas Lepontiorum, und gehörte vermutlich zu einem
reichen Landsitz der lokalen Elite.
Genau
genommen handelt es sich im Erhaltungszustand des archäologischen Befundes um
Grabeinbauten in Gestalt teils gemauerter teils aus schweren Steinplatten errichteter
Grabkammern. Diese Merkmale treffen auf eine kleine, exklusive Gruppe reich ausgestatteter
Gräber innerhalb der Nekropole von Minusio-Cadra zu, von der insgesamt 33 Gräber
freigelegt wurden. Der Friedhof lag an einem exponierten Hang oberhalb von Locarno,
dem Hauptort der civitas Lepontiorum, und gehörte vermutlich zu einem
reichen Landsitz der lokalen Elite.  Schauen
wir uns die eigenartigen Befunde am Beispiel des Kammergrabes Nr. 31 aus dem frühen
1. Jahrhundert etwas näher an. Die Wände des 2,7 x 1,5 m großen Raumes sind unter
dem Einfluss römischer Technik bereits gemörtelt, während die älteren sowie auch
die bescheideneren Kammergräber noch immer mit Trockenmauern stabilisiert sind.
Zwei schwere, mit Bleidübeln verbundene Steinplatten bilden den unterirdischen
Dachgiebel.
Schauen
wir uns die eigenartigen Befunde am Beispiel des Kammergrabes Nr. 31 aus dem frühen
1. Jahrhundert etwas näher an. Die Wände des 2,7 x 1,5 m großen Raumes sind unter
dem Einfluss römischer Technik bereits gemörtelt, während die älteren sowie auch
die bescheideneren Kammergräber noch immer mit Trockenmauern stabilisiert sind.
Zwei schwere, mit Bleidübeln verbundene Steinplatten bilden den unterirdischen
Dachgiebel.
Die Vorbilder stammen offenbar aus Etrurien, worauf auch die verputzten und
bemalten Innenwände hindeuten. Der Innenraum war mit einem Plattenfußboden ausgestattet.
Stets hat man die Kammern nur mit einer oder zwei Körperbestattungen belegt.
Es handelt sich also um abgeschlossene, unzugängliche Kammergräber und nicht
um Familien-Grabkammern (hypogaia), die für die Aufnahme von Urnen
oder Sarkophagen über mehrere Generationen hinweg konzipiert waren. Das Festhalten
an der Körperbestattung bis mindestens um 50 n. Chr. sowie der Beigabenreichtum
setzen eine indigene, keltisch geprägte Bestattungssitte der späten Eisenzeit
fort. Neben umfangreichen Geschirrbeigaben werden Männer mit Waffen (Lanzen,
seltener Äxte), Spielbrett und strigiles, Frauen mit mehr oder weniger
reichem Gold- und Silberschmuck sowie mit Spiegeln ausgestattet. Derartige aus
einer einheimischen Tradition mit römischer Bautechnik weiterentwickelten und
mit römischen Objekten (z. B. Terra Sigillata, strigiles) ausgestatteten
Kammergräber sind regionalspezifisch und haben in Rätien ansonsten keine Nachahmung
gefunden. Im Bereich des Lago Maggiore wurden sie bis in das 2. Jahrhundert
hinein angelegt, erst danach lässt sich diese Grabbausitte nicht mehr weiter
verfolgen. Nach Süden reicht sie zumindest in die Transpadana (italische regio
XI) hinein, wo in der Nekropole von Ornavasso sogar mit Marmorvertäfelung
ausgekleidete Kammergräber vorkommen (Martin-Kilcher 1998, 216).
Eine bescheidene Ausführung von Kammergräbern stellen hausförmige Ziegelgräber
aus tegulae oder mit Steinen umstellte Körpergräber dar, wie sie beispielsweise
im Gräberfeld eines Gutshofs (?) bei Roveredo, ca. 10 km nordöstlich von Bellinzona
gelegen, vorherrschen (Metzger 2004). Ziegelplattengräber sind aber auch in
den nordwestlichen Provinzen verbreitet und daher an sich unspezifisch.
Ein weiteres besonderes Merkmal sind seitlich an das Kammergrab angefügte Beigabennischen,
die im Falle von Cadra Grab 31 einen 1,1 x 1,1 m großen Innenraum umfasst. Dieser
war mit Regalen aus Granitplatten zur Aufnahme der Gefäßbeigaben eingerichtet.
Diese eng mit den Kammergräbern verbundenen Einbauten sind nach derzeitigem
Kenntnisstand in anderen Gebieten Rätiens nicht rezipiert worden. Erst viel
weiter nördlich, in Niedergermanien, kommen – meist aus drei oder vier aufrecht
gestellten Ziegeln gesetzte – Beigabennischen bei reich bis durchschnittlich
ausgestatteten Gräbern regelmäßig vor. Ob zwischen den beiden zeitlich und räumlich
getrennten Erscheinungsformen desselben Phänomens Zusammenhänge bestehen, ist
noch nicht gründlich genug erforscht.
Die Mauern setzen sich bei gut erhaltenen Befunden über dem Steinplattengiebel
nach oben fort, so dass sie als Fundamente obertägiger Grabbauten gedient haben
dürften. Zu rechnen ist mit Kapellen, Grabtempeln (memoriae, aediculae)
oder Grabaltären.
Obwohl es nicht an umfangreich erforschten Gräberfeldern mangelt, sind im nordalpinen Rätien bisher nur wenige und eher bescheidene Grabbauten des 1. Jahrhunderts entdeckt worden – jedenfalls wenn man sie an der gleichzeitigen Entwicklung zwischen Mainz und Köln misst. Hier ist das Fehlen einer provinzeigenen Legion als wirtschaftlicher und kultureller Motor deutlich spürbar.
 In
Cambodunum/Kempten, der mutmaßlichen Provinzhauptstadt zwischen ca. 20 und 70
n. Chr., sind große Partien der Gräberstraße „Auf der Keckwiese“ untersucht
worden, die sich nördlich der antiken Stadt an der Fernstraße nach Augsburg
erstreckt (Mackensen 1978; Faber 1998; Faber 2000). Sie war sicherlich die bedeutendste
Verkehrsanbindung Kemptens und daher für repräsentative Grabdenkmäler prädestiniert.
In
Cambodunum/Kempten, der mutmaßlichen Provinzhauptstadt zwischen ca. 20 und 70
n. Chr., sind große Partien der Gräberstraße „Auf der Keckwiese“ untersucht
worden, die sich nördlich der antiken Stadt an der Fernstraße nach Augsburg
erstreckt (Mackensen 1978; Faber 1998; Faber 2000). Sie war sicherlich die bedeutendste
Verkehrsanbindung Kemptens und daher für repräsentative Grabdenkmäler prädestiniert.
Der Forschungsstand dürfte auch deswegen einen annähernd repräsentativen Eindruck vermitteln, weil die Grabungsflächen vor allem die stadtnahen und somit für Grabbauten prinzipiell attraktivsten Grundstücke erfasst haben. Andererseits wird im nächsten Kapitel eine zur Vorsicht mahnende Ausnahme von dieser Regel zu besprechen sein. Es soll vorab auch nicht verschwiegen werden, dass die Überlieferung von Steindenkmälern in Cambodunum außerordentlich schlecht ist. Grabstelen fehlen bis heute, die einzige Grabinschrift gehört zu einem Pfeilergrabmal des 2.-3. Jahrhunderts. Ansonsten sind von der Kemptener Gräberstraße nur Graffiti auf Beigabegefäßen bekannt. Auch an anderen Steindenkmälergattungen besteht erheblicher Mangel, gemessen an der einstigen Bedeutung der Siedlung und den daher eigentlich zu erwartenden Beständen (CSIR I, 1 Nr. 196-203). Andererseits sind die spätantiken Festungsmauern auf Spolien hin kaum untersucht worden. Vieles mag darüber hinaus als wohlfeiles Baumaterial für weitere Befestigungen illerabwärts verschleppt worden sein. Marmor wiederum, der als Baumaterial im frühkaiserzeitlichen Cambodunum bezeugt ist, gilt als bevorzugtes Rohmaterial zum Kalkbrennen in späteren Epochen. Es kommt hinzu, dass die Gräberfelder an den anderen Ausfallstraßen der Stadt nicht oder kaum untersucht worden sind. Dass dort noch weitere Grabbaufundamente im Boden schlummern, mag man immerhin hoffen. Diese überlieferungskritischen Ausführungen sind keineswegs müßig, denn nicht allerorts trifft man auf deutlich günstigere Verhältnisse. Ein glücklicher Neufund, wie z. B. der „Massenfund“ von Köln, könnte die nachfolgend formulierten Tendenzen jederzeit gründlich modifizieren.
Um 20 n. Chr. setzt an der Gräberstraße „Keckwiese“ der Grabbau mit rechteckigen
bis quadratischen, etwas seltener auch runden Gräbcheneinfriedungen ein, mit
denen der erworbene oder vom Stadtrat (ordo decurionum) einer Familie,
Bestattungs- oder Erbengemeinschaft zugewiesene Grabgarten (cepotaphium)
für jedermann sichtbar abgegrenzt wurde (Mackensen 1978, 126-133). Unterschiedliche
Erdeinfüllungen in den Gräbchen lassen die Interpretation zu, dass manche mit
Hecken (?) bepflanzt waren, andere hingegen eher längere Zeit offenstanden,
so dass nur durch den Graben selbst die obertägige Markierung des Grabareals
oder –gartens gewährleistet war. In manchen Gräbchen fand man vertiefte Pfostenstellungen,
die von einem Zaun herrühren könnten (Mackensen 1978, 132 f.). Während des ganzen
1. Jahrhunderts stellen Gräbchenumfriedungen die dominierende Form der Kemptener
Grabanlagen. Ihr Vorkommen ist aber keineswegs auf Rätien oder das 1. Jahrhundert
beschränkt, vielmehr findet sich diese praktikable und kostengünstige obertägige
Sichtbarmachung von Grabbezirken auch in den angrenzenden Provinzen (vgl. die
Beiträge zu Ober- und Niedergermanien). Daher ist diese Grabbauform hinsichtlich
der Herkunftsbestimmung der hier bestatteten Bevölkerung unspezifisch. Die in
ihnen vorgefundenen Gräber – oft gibt es nur ein einziges zentrales Grab, manchmal
umhegen sie mehrere – haben in der Regel die typisch römisch-italische Ausstattung
als Sekundärbeigaben erhalten: balsamarium, Lampe, Münze und manchmal auch Krüge.
Von diesen heben sich Gräber mit Fibelbeigabe ab, die sich ohne jeglichen archäologisch
erkennbaren Grabbau auf die freien Zwischenräume zwischen den Einfriedungen
verteilen. Sie können in die Zeit ab 20/30 n. Chr. datiert werden. Soweit die
Fibeln Rückschlüsse auf ihre Träger zulassen, deuten sie auf Einwanderer aus
dem Trierer Land, dem germanischen Barbaricum und aus den Alpen hin (Fasold/Witteyer
2001, 298).
Steinerne Grabbauten lassen sich erst in claudisch-neronischer Zeit fassen.
Unter ihnen sticht Grab 32 mit seiner Einfriedungsmauer von 12,2 x 12,4 m Außenmaß
hervor. Diese Mauer (maceria) – im Grunde eine monumentale Variante
der zuvor beschriebenen Erdeinfriedungen – war verhältnismäßig stark fundamentiert,
um schwere walzenförmige Decksteine tragen zu können. Nach erhaltenen Beispielen
aus Aquileia (bei Venedig) ist mit einer Höhe von ca. 1,5 m zu rechnen. Das
zentrale Grab umgab ein rundes Fundament von 3,9 m Außendurchmesser und 0,6
m Mauerstärke. Hierauf dürfte ein Erd- oder Kieshügel zu rekonstruieren sein,
der mit einer bis zu 2,5 m hohen Quadermauer umrahmt war (tumulus).
Diese altehrwürdige italische Grabbauform wurde in der frühen Kaiserzeit ohne
Zweifel noch mit einem privilegierten sozialen Status des oder der darin Bestatteten
assoziiert (s. Grabbauten
in Niedergermanien). Dies unterstreicht auch die vornehme Lage des Grabmals
nahe am Nordrand der Siedlung, wo sich zwei städtische Hauptstraßen zur Fernstraße
vereinigen und der Beginn der Gräberstraße in etwa zu erwarten ist. Hierin offenbart
sich eine gewisse Parallele zu jenem, wenn auch erheblich größeren tumulus
vor dem Osttor der Colonia Augusta Raurica (s. Grabbauten in Obergermanien).
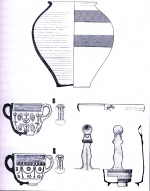 Wer
war hier beigesetzt? Leider wurde das zentrale Grab 32 in bereits gestörtem
Zustand angetroffen, so dass weder eine anthropologische Bestimmung von Leichenbrandresten
vorliegt noch aus den übrigen Beigaben eine zuverlässige Aussage über die kulturellen
Wurzeln der Person abgeleitet werden kann. Da es sich offenbar um ein Brandschüttungsgrab
handelte, ist eine im weiteren Sinne keltische, vielleicht sogar einheimische
Herkunft nicht ausgeschlossen. Innerhalb der Einfriedung befanden sich noch
zwei weitere Gräber. Das Brandschüttungsgrab 34 mit Urne führte Gefäßbeigaben
und Trinkgeschirr mit einem bronzenem simpulum für den Weingenuss.
Wer
war hier beigesetzt? Leider wurde das zentrale Grab 32 in bereits gestörtem
Zustand angetroffen, so dass weder eine anthropologische Bestimmung von Leichenbrandresten
vorliegt noch aus den übrigen Beigaben eine zuverlässige Aussage über die kulturellen
Wurzeln der Person abgeleitet werden kann. Da es sich offenbar um ein Brandschüttungsgrab
handelte, ist eine im weiteren Sinne keltische, vielleicht sogar einheimische
Herkunft nicht ausgeschlossen. Innerhalb der Einfriedung befanden sich noch
zwei weitere Gräber. Das Brandschüttungsgrab 34 mit Urne führte Gefäßbeigaben
und Trinkgeschirr mit einem bronzenem simpulum für den Weingenuss.
Das Brandgrubengrab 35 hingegen barg nur noch wenige Ausstattungsreste, da
es beim Bau der Mauer gestört worden war. Zwei benachbarte „Kultgruben“ bargen
Deponierungen, die man wohl im Rahmen von Gedenkzeremonien hier niederlegte.
All dies verdichtet das Bild einer bereits gut romanisierten, aber aus keltischen
Wurzeln entsprossenen Personengruppe. Bei aller gebotenen Vorsicht erscheint
es nicht abwegig, die Grabstätte einem der ersten decuriones von Cambodunum
und dessen Familie zuzuschreiben, der hier vielleicht infolge eines öffentlichen
Begräbnisses (funus publicum) in den Genuss eines Ehrengrabmals auf
exponiertem kommunalem Grund gekommen ist. Ein hinter der Umfassungsmauer befindlicher
Brunnen mag der Pflege des Grabgartens gedient haben.
Unter den 407 übrigen Gräbern dieses Gräberfeldausschnitts sind im 1. Jahrhundert
nur drei weitere mit steinernen Einfriedungsmauern markiert worden. Einem anderen
Grabmaltypus ist die quadratische Rollsteinsetzung von 2,4 m Seitenlänge um
Grab 241 zuzurechnen. Bei genauerer Betrachtung der Bauweise stellt sich heraus,
dass die „Mauer“ nur durch eine dünne Kiesellage auf der antiken Oberfläche
fundamentiert war und daher für aufgehende Steinkonstruktionen kaum tragfähig
gewesen wäre. Gemäß Beispielen aus Osträtien und Westnoricum ist hier eher mit
einem Unterbau für eine Hügelaufschüttung in der Art eines kleinen tumulus
zu rechnen (Mackensen 1978, 130). Hierauf wird später noch einmal zurückzukommen
sein.
In Augsburg ist der Bestand an sicher in das 1. Jahrhundert datierbarer Grabmalarchitektur einstweilen gering, obgleich einige militärische wie zivile Grabstelen seit der frühen Kaiserzeit vorhanden sind. Das Fragment eines Waffenfrieses (CSIR I, 1 Nr. 72) könnte von einem Mausoleum stammen. Wenn man das kleine Bruchstück überhaupt mit dem entsprechenden Reliefschmuck rheinischer Mausoleen in Verbindung bringen darf, möchte man eine Datierung noch in das 1. Jahrhundert bevorzugen. Immerhin wären derartige Denkmäler in Augsburg, dem einzigen größeren Truppenlager Rätiens bis in flavische Zeit, am ehesten zu erwarten.

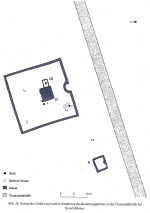 Weitere
steinerne Grabbauten hat man an der in tiberisch-claudischer Zeit ausgebauten
Donausüdstraße (via iuxta Danuvii) bei Günzburg entdeckt. Von herausragender
Bedeutung ist ein bei Nersingen-Unterfahlheim (Ldkr. Neu-Ulm) ausgegrabenes
Monument (Ambs/Faber 1998), das nach den Beigaben seines Hauptgrabes zu urteilen
in neronischer Zeit errichtet wurde. Es gehört damit zu den ältesten der Provinz.
Die Dimensionen der fast quadratischen Einfriedungsmauer (23,7 x 22,9 m) übertreffen
die Maße des Kemptener Grabbaus fast um das Doppelte, obwohl als nächste größere
Siedlung „nur“ das 6 km weiter westlich gelegene Gontia/Günzburg bekannt ist.
Sollten die hier Bestatteten aber, was zu Recht vermutet wird, Bewohner einer
in der Nähe gelegenen Villa gewesen sein, so wäre dieses vorerst singuläre Denkmal
für die Besiedlungsgeschichte an der damals gerade erst 20-30 Jahre alten Militärgrenze
entlang der Donau von hoher Relevanz. Es sei daher erlaubt, etwas näher auf
diesen Grabbau einzugehen.
Weitere
steinerne Grabbauten hat man an der in tiberisch-claudischer Zeit ausgebauten
Donausüdstraße (via iuxta Danuvii) bei Günzburg entdeckt. Von herausragender
Bedeutung ist ein bei Nersingen-Unterfahlheim (Ldkr. Neu-Ulm) ausgegrabenes
Monument (Ambs/Faber 1998), das nach den Beigaben seines Hauptgrabes zu urteilen
in neronischer Zeit errichtet wurde. Es gehört damit zu den ältesten der Provinz.
Die Dimensionen der fast quadratischen Einfriedungsmauer (23,7 x 22,9 m) übertreffen
die Maße des Kemptener Grabbaus fast um das Doppelte, obwohl als nächste größere
Siedlung „nur“ das 6 km weiter westlich gelegene Gontia/Günzburg bekannt ist.
Sollten die hier Bestatteten aber, was zu Recht vermutet wird, Bewohner einer
in der Nähe gelegenen Villa gewesen sein, so wäre dieses vorerst singuläre Denkmal
für die Besiedlungsgeschichte an der damals gerade erst 20-30 Jahre alten Militärgrenze
entlang der Donau von hoher Relevanz. Es sei daher erlaubt, etwas näher auf
diesen Grabbau einzugehen.
Ein bemerkenswertes Gestaltungselement stellt die halbrunde Exedra in der Straßenfront
dar. Man darf gewiss annehmen, dass sie familiären Versammlungen zu Ehren des/der
Toten diente, jedenfalls gemäß ihrer ursprünglichen Intention. Vergleiche aus
Pompeji lehren, dass entlang solcher Exedren mit Sitzbänken zu rechnen ist.
Sie zeigen darüber hinaus aber noch etwas anderes: in der frühen Kaiserzeit
waren Grabbauten, denen derartige Exedren vorgebaut waren, vor allem städtischen
Ehrenbürgern und Magistraten (duumviri) vorbehalten, jedenfalls in
Italien (Faber 1998). Sollte es sich hierbei nicht nur um ein von südlichen
Vorbildern abgeschautes Gestaltungselement handeln, sondern zugleich auch der
Sinngehalt dieser halbrunden Aussparung rezipiert worden sein, eröffnete dieses
Detail wertvolle Ausblicke auf den sozialen Status der hier beigesetzten Personen.
Die schiere Größe, d. h. Kostspieligkeit, eines Grabbaus ermöglicht dies nach
allen Erfahrungen mit dieser Denkmälergattung nämlich nicht. Vom eigentlichen
Grabbau ist nur noch das wuchtige, aus Tuffquadern in Mörtellagen gesetzte Fundament
von 5,2 m Seitenlänge und 1 m Tiefe erhalten, das für einen hoch aufragenden
Baukörper ausgelegt war. Architekturtrümmer fehlen zwar, doch kommt auch hinsichtlich
der Zeitstellung am ehesten ein zweigeschossiges Mausoleum in Frage (zur Definition
s. Grabbauten in Niedergermanien).
Die Architektur ist also direkt italischen Vorbildern entlehnt, doch woher kam(en)
der oder die Bauherren wirklich? Da hier Grabbau und Gräber in wünschenswerter
Vergesellschaftung überliefert sind, sei es erlaubt, in einem kurzen Exkurs
die Aussagemöglichkeiten von Grabbrauch und Beigaben zu referieren (Ambs/Faber
1998, 424-448). Neben der Hauptbestattung eines 40-60 jährigen Mannes (Grab
1) innerhalb einer gesonderten Einfassung an der Seite des Grabbaus wurden fünf
weitere Urnengräber mit und ohne Brandschüttung innerhalb der Ummauerung gefunden.
Sie dürften Mitgliedern der familia zuzuschreiben sein.
 Schreibgeräte
(vier silberne stili in einem Frauengrab), Trink- und Tafelgeschirr
sowie Toiletteutensilien folgen prinzipiell italischer Beigabentradition. Das
Vorhandensein von Flüssigkeitsbehältern (Krüge, Amphoren) bezeugt die mediterrane
Sitte des mit Weingenuss verbundenen Totenmahls und des Löschens des heruntergebrannten
Scheiterhaufens mit Wein. Auch das Ausgießen von Duftölen aus balsamaria über
dem Leichnam sowie mehrere Öllampen und ein tönernes Lichthäuschen, die im Rahmen
des Totenkultes an den Gräbern niedergelegt, aber nicht als Primärbeigaben mitverbrannt
wurden, entsprechen italischen Bestattungsriten. Anders verhält es sich mit
den Tierknochen, denn üppigere Speisebeigaben wurzeln vornehmlich in keltischem
Totenbrauchtum, obwohl auch in Ober- und Mittelitalien Belege für diese Praxis
nicht völlig ausbleiben. Trachtbeigaben, hier in Form einer sog. „kräftig profilierten“
Fibel im Frauengrab 3 nachvollziehbar, finden sich ebenfalls in keltisch geprägten
Gebieten, Norditalien inbegriffen. Das 23 cm lange Eisenmesser aus dem Männergrab
5 darf man vielleicht als Jagdwaffe deuten und damit als ein Standessymbol keltischer
Tradition. Überhaupt wird die Mitgabe persönlichen Besitzes ins Grab mit keltischen
Jenseitsvorstellungen einer Wiedergeburt nach den Maßstäben des Diesseits o.
ä. verbunden (Meyer 2003, 635). Die Beigabe tiergestaltiger Terrakottafiguren
schließlich wurde außer in Rätien vor allem von Mittelgallien bis in die Gallia
Belgica hinein gepflegt; südlich der Alpen dominieren hingegen anthropomorphe
Figuren, vor allem Götter. Mittelgallischer Provenienz ist vermutlich auch ein
mit Appliken verzierter und glasierter Becher (Grab 3). Da solche Gefäße in
Rätien nicht regelhaft importiert wurden, ist hier am ehesten mit einem individuellen
„Mitbringsel“ zu rechnen, das möglicherweise auf die Heimatregion der Bestatteten
hinweist. Die Adaption zahlreicher Elemente des in Italien gepflegten Totenkults
bei gleichzeitiger Beibehaltung keltisch geprägter Grundvorstellungen könnte
in der Tat für eine in der frühen Kaiserzeit aus Gallien zugewanderte Familie
sprechen. Umgekehrt fehlt jede Verknüpfungsmöglichkeit mit einer – bisher auch
nicht definierbaren – einheimischen Tradition.
Schreibgeräte
(vier silberne stili in einem Frauengrab), Trink- und Tafelgeschirr
sowie Toiletteutensilien folgen prinzipiell italischer Beigabentradition. Das
Vorhandensein von Flüssigkeitsbehältern (Krüge, Amphoren) bezeugt die mediterrane
Sitte des mit Weingenuss verbundenen Totenmahls und des Löschens des heruntergebrannten
Scheiterhaufens mit Wein. Auch das Ausgießen von Duftölen aus balsamaria über
dem Leichnam sowie mehrere Öllampen und ein tönernes Lichthäuschen, die im Rahmen
des Totenkultes an den Gräbern niedergelegt, aber nicht als Primärbeigaben mitverbrannt
wurden, entsprechen italischen Bestattungsriten. Anders verhält es sich mit
den Tierknochen, denn üppigere Speisebeigaben wurzeln vornehmlich in keltischem
Totenbrauchtum, obwohl auch in Ober- und Mittelitalien Belege für diese Praxis
nicht völlig ausbleiben. Trachtbeigaben, hier in Form einer sog. „kräftig profilierten“
Fibel im Frauengrab 3 nachvollziehbar, finden sich ebenfalls in keltisch geprägten
Gebieten, Norditalien inbegriffen. Das 23 cm lange Eisenmesser aus dem Männergrab
5 darf man vielleicht als Jagdwaffe deuten und damit als ein Standessymbol keltischer
Tradition. Überhaupt wird die Mitgabe persönlichen Besitzes ins Grab mit keltischen
Jenseitsvorstellungen einer Wiedergeburt nach den Maßstäben des Diesseits o.
ä. verbunden (Meyer 2003, 635). Die Beigabe tiergestaltiger Terrakottafiguren
schließlich wurde außer in Rätien vor allem von Mittelgallien bis in die Gallia
Belgica hinein gepflegt; südlich der Alpen dominieren hingegen anthropomorphe
Figuren, vor allem Götter. Mittelgallischer Provenienz ist vermutlich auch ein
mit Appliken verzierter und glasierter Becher (Grab 3). Da solche Gefäße in
Rätien nicht regelhaft importiert wurden, ist hier am ehesten mit einem individuellen
„Mitbringsel“ zu rechnen, das möglicherweise auf die Heimatregion der Bestatteten
hinweist. Die Adaption zahlreicher Elemente des in Italien gepflegten Totenkults
bei gleichzeitiger Beibehaltung keltisch geprägter Grundvorstellungen könnte
in der Tat für eine in der frühen Kaiserzeit aus Gallien zugewanderte Familie
sprechen. Umgekehrt fehlt jede Verknüpfungsmöglichkeit mit einer – bisher auch
nicht definierbaren – einheimischen Tradition.
Was lehrt uns die Betrachtung des Kemptener tumulus und des Unterfahlheimer (falls richtig rekonstruiert) Mausoleums? Zunächst werden – wie so oft in der Archäologie – neue Fragen aufgeworfen, insbesondere in der Zusammenschau mit einer Bauinschrift, die wahrscheinlich von einem Grabmonument stammt. Dieses datiert schon in die 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts und ist als eigentlicher Befund (tumulus oder Mausoleum?) auch leider nicht bekannt, hat aber den entscheidenden Vorzug, dass seine monumentale Inschrift (titulus) erhalten blieb. Durch sie und eine weitere Inschrift lässt sich der Aufstieg einer Familie des rätischen „Provinzialadels“ bis in claudisch-neronische Zeit zurückverfolgen. Für rätische Verhältnisse ist das singulär. Gemeint ist die aus mehreren Blöcken zusammengesetzte, ursprünglich über 2 m hohe Grabinschrift des Claudius Paternus Clementianus aus Epfach, des einzigen bekannten, aus Rätien stammenden Ritters, der in der Reichsverwaltung Karriere machte und als prokuratorischer Statthalter der Provinz Noricum um 130 n. Chr. aus dem Staatsdienst ausschied (Dietz 1985). Die Inschrift ist zwar nur teilweise als Spolienmaterial in der spätantiken Befestigungsmauer des Lorenzberges oberhalb Epfach erhalten geblieben, lässt sich aber durch eine mitgefundene Statuenbasis (?), die möglicherweise vor dem sepulcrum aufgestellt war und die Laufbahn vollständig wiedergibt, zweifelsfrei rekonstruieren (Kraft 1964; AE 1968, 406; Bakker 2005):
[---? / Cl(audius) P]aternus Cleme[n]/[tian(us)] proc(urator) Au[g(usti)] / [provinciarum Iudaeae, Sardiniae, Africae et Norici]? / praef(ectus) eq(uitum) alae Silia[nae] / torquatae c(ivium) R(omanorum) / trib[un]us mi[litum] / leg(ionis) [XI Claud(iae)] / [praef(ectus) coh(ortis) I Cla]ssicae [monumentum vivus oder sibi et suis vivus o. ä.] fecit. – frei übersetzt: „Claudius Paternus Clementianus hat [den Bau dieses Grabdenkmals noch zu Lebzeiten für sich und die Seinen?] errichten lassen. Er (war zuletzt) kaiserlicher Statthalter (ritterlichen Ranges) der Provinzen Iudaea und (danach) Noricum. (Zuvor war er) Verwalter der kaiserlichen Provinzkassen von Sardinien und (danach) von Africa (proconsularis), (davor) Kommandeur des 500 Mann starken Reiterregiments (das sich nach seinem ersten Befehlshaber) `Siliana´ (nennt, das) mit einem Ehrenring dekoriert (ist und dessen Soldaten einmal ehrenhalber) mit dem römischen Bürgerrecht ausgezeichnet (wurden), (zuvor war er) Adjutant (im ritterlichen Rang) der 11. Legion Claudia und (am Anfang seiner Laufbahn) Kommandeur der 1. Kohorte (die aus) Marinesoldaten (aufgestellt worden war)“.
Dass dieser Mann in Rätien beheimatet war, bekräftigt ferner die Grabinschrift (vermutlich eines weiteren Grabbaus) seiner Mutter, die Tochter eines Mannes mit dem keltischen Namen Indutus war. Dieser titulus offenbart also, dass die Großeltern entweder einheimische Vindeliker waren oder zumindest aus einer keltisch-gallisch geprägten Region stammten (IBR 87; Kraft 1964):
Vermutlich hatte Claudia Clementina das römische Bürgerrecht zusammen mit ihrem Mann, dem Vater des Procurators, unter den Kaisern Claudius oder Nero erhalten. Kaiser Claudius ist dafür bekannt, dass er führende Persönlichkeiten gallischer civitates in den Ritterstand erhoben hat. Sind vielleicht auch die namentlich unbekannten Auftraggeber der o. g. Grabbauten von Kempten und Unterfahlheim zur gleichen Zeit mit personenrechtlichen Privilegien begünstigt worden? Manches spricht dafür. Und wenn ja, sind diese Leute aus einem einheimisch-vindelikischen Adel hervorgegangen oder aber aus zugezogenen Galliern? Die Beantwortung dieser Frage wird in der Forschung anhaltend heiß diskutiert (Zanier 2004, 240-242).
 Die
Grabbauten mehr oder weniger vermögender Provinzbewohner unterhalb dieser rätischen
„Prominenz“ sind deutlich bescheidener ausgefallen. Die Kemptener Befunde wurden
bereits oben angesprochen, weitere Beispiele für Einfriedungsmauern gibt es
aus Brigantium/Bregenz (Faber 2001, 310) und Gontia/Günzburg (Czysz 2002). In
den Gräberfeldern dieser Orte finden sich auch weitere Beispiele von Exedren,
die man aufgrund ihrer Größe und Lage innerhalb des Gräberfeldes jedoch eher
als „architektonische Zitate“ denn als ernsthafte Hinweise auf Ehrengräber verstehen
möchte. Das 7 x 6,5 m messende Günzburger Grabbaufundament ist noch nicht sicher
rekonstruierbar.
Die
Grabbauten mehr oder weniger vermögender Provinzbewohner unterhalb dieser rätischen
„Prominenz“ sind deutlich bescheidener ausgefallen. Die Kemptener Befunde wurden
bereits oben angesprochen, weitere Beispiele für Einfriedungsmauern gibt es
aus Brigantium/Bregenz (Faber 2001, 310) und Gontia/Günzburg (Czysz 2002). In
den Gräberfeldern dieser Orte finden sich auch weitere Beispiele von Exedren,
die man aufgrund ihrer Größe und Lage innerhalb des Gräberfeldes jedoch eher
als „architektonische Zitate“ denn als ernsthafte Hinweise auf Ehrengräber verstehen
möchte. Das 7 x 6,5 m messende Günzburger Grabbaufundament ist noch nicht sicher
rekonstruierbar.
 In
seinem Inneren wurden vier Brandbestattungen entdeckt, so dass man sich den
Grabbau als Variante der üblichen Umfriedungsmauern wie in Unterfahlheim vorstellen
kann. Dann allerdings würde man ein zentrales Monument vermissen. Beachtung
verdient daher der alternative Rekonstruktionsvorschlag als Grabtempel oder
columbarium („Taubenschlag“) mit Kuppeldach, in dem Urnen auch obertägig
in Nischen, Regalen o. ä. aufgestellt waren (Fasold/Weber 1985, 199; Czysz 2002,
161). Aus Ostia und Rom gibt es Vergleiche sowohl für offene als auch für überdachte
columbaria. Diese Idee wurde durch den Fund einer Porträtbüste aus
Kalkstein in der Donau bei Günzburg inspiriert. Dass die kleinen quadratischen
Grundmauern an der Günzburger Gräberstraße durchaus tempelartige Aufbauten oder
Kapellen (aediculae oder memoriae) getragen haben können,
zeigen Funde von Eckakroteren mit Volutenverzierung.
In
seinem Inneren wurden vier Brandbestattungen entdeckt, so dass man sich den
Grabbau als Variante der üblichen Umfriedungsmauern wie in Unterfahlheim vorstellen
kann. Dann allerdings würde man ein zentrales Monument vermissen. Beachtung
verdient daher der alternative Rekonstruktionsvorschlag als Grabtempel oder
columbarium („Taubenschlag“) mit Kuppeldach, in dem Urnen auch obertägig
in Nischen, Regalen o. ä. aufgestellt waren (Fasold/Weber 1985, 199; Czysz 2002,
161). Aus Ostia und Rom gibt es Vergleiche sowohl für offene als auch für überdachte
columbaria. Diese Idee wurde durch den Fund einer Porträtbüste aus
Kalkstein in der Donau bei Günzburg inspiriert. Dass die kleinen quadratischen
Grundmauern an der Günzburger Gräberstraße durchaus tempelartige Aufbauten oder
Kapellen (aediculae oder memoriae) getragen haben können,
zeigen Funde von Eckakroteren mit Volutenverzierung.
Über die Steinfundamente hinwegziehende Fahrspuren zeigen an, dass die Grabbauten bereits in der Spätantike dem Steinraub zum Opfer gefallen sind. Im Günzburger Gräberfeld wird übrigens die Aufreihung der steinernen Grabbauten „an den besten Plätzen“ entlang der Straßenfront besonders deutlich, während sich die mit Gräbchen umfriedeten Gräber oder Grabbezirke erst dahinter anschließen – sei es, weil sich die betreffenden Familien Plätze in der „ersten Reihe“ nicht leisten konnten oder weil sie erst später entstanden sind. In diesem Bereich wurde außerdem eine auf vier Pfosten gebaute, hölzerne memoria entdeckt. Zwei derartige Holzgrabbauten stellte man auch im Gräberfeld der Straßenstation von Sontheim/Brenz fest (Nuber/Schaub 1991, 175 f.).
 Schwerer
rekonstruierbar (als aedicula?) erscheint das halbkreisförmige Fundament
von 4,5 m Durchmesser im Gräberfeld von Bregenz, da ihm offenbar ein (steinerner)
Vorbau fehlt und es außerdem von der Straße abgewandt liegt. Am ehesten dürfte
es als gemauerte aedicula zu ergänzen sein, in der vielleicht Statuen
aufgestellt waren. Es könnte sein, dass ein zugehöriger Grabgarten bei den Altgrabungen
vielleicht nicht erkannt wurde. Ähnliche Kombinationen kennt man beispielsweise
aus der Gallia Belgica. Das Testament eines wohlhabenden Galliers, das sog.
„Lingonentestament“ (CIL XIII 5708), sieht vor, dass in einer steinernen Exedra
seine Grabstatue aufzustellen war.
Schwerer
rekonstruierbar (als aedicula?) erscheint das halbkreisförmige Fundament
von 4,5 m Durchmesser im Gräberfeld von Bregenz, da ihm offenbar ein (steinerner)
Vorbau fehlt und es außerdem von der Straße abgewandt liegt. Am ehesten dürfte
es als gemauerte aedicula zu ergänzen sein, in der vielleicht Statuen
aufgestellt waren. Es könnte sein, dass ein zugehöriger Grabgarten bei den Altgrabungen
vielleicht nicht erkannt wurde. Ähnliche Kombinationen kennt man beispielsweise
aus der Gallia Belgica. Das Testament eines wohlhabenden Galliers, das sog.
„Lingonentestament“ (CIL XIII 5708), sieht vor, dass in einer steinernen Exedra
seine Grabstatue aufzustellen war.

 Das
2,1 x 2,9 m große Fundament einer Totenmemoria mit Exedra wurde im Vicus des
Gräberfeldes von Dambach (Ldkr. Ansbach) am rätischen Limes ergraben, doch ist
dieses Grabgebäude erst während der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts entstanden
(Leja/Thoma 1990). Diesem Befund ist ein 4,2 x 4,6 m großes Grabhaus mit Apsis
an der Gräberstraße von Sontheim/Brenz an die Seite zu stellen, in dessen Zentrum
sich ein reich ausgestattetes Frauengrab befand (Schaub 1990, 160). Diese Anlage
wird in das 2. Jahrhundert datiert.
Das
2,1 x 2,9 m große Fundament einer Totenmemoria mit Exedra wurde im Vicus des
Gräberfeldes von Dambach (Ldkr. Ansbach) am rätischen Limes ergraben, doch ist
dieses Grabgebäude erst während der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts entstanden
(Leja/Thoma 1990). Diesem Befund ist ein 4,2 x 4,6 m großes Grabhaus mit Apsis
an der Gräberstraße von Sontheim/Brenz an die Seite zu stellen, in dessen Zentrum
sich ein reich ausgestattetes Frauengrab befand (Schaub 1990, 160). Diese Anlage
wird in das 2. Jahrhundert datiert.

 Markante
Unterschiede weisen Grabbau und Grabbrauch in der Osthälfte Rätiens auf. Dort
pflegte man bis ins 2. Jahrhundert hinein Nachbestattungen in prähistorischen
Grabhügeln. Daneben schüttete man auch neue Grabhügel auf, so z. B. Hügel B in
der Nekropole von Niedererlbach (Ldkr. Landshut), im Isartal nahe der Fernstraße
Augsburg – Moos-Burgstall gelegen, unter dem sich ein Ziegelplattengrab befand
(Faber/Koch 2004). In den westlichen Provinzteilen sind kleinere, von Kreisgräben
eingefasste Grabhügel zwar nicht unbekannt (z. B. Kempten, Oberpeiching), kommen
dort aber im Gegensatz zum Osten eher sporadisch vor.
Markante
Unterschiede weisen Grabbau und Grabbrauch in der Osthälfte Rätiens auf. Dort
pflegte man bis ins 2. Jahrhundert hinein Nachbestattungen in prähistorischen
Grabhügeln. Daneben schüttete man auch neue Grabhügel auf, so z. B. Hügel B in
der Nekropole von Niedererlbach (Ldkr. Landshut), im Isartal nahe der Fernstraße
Augsburg – Moos-Burgstall gelegen, unter dem sich ein Ziegelplattengrab befand
(Faber/Koch 2004). In den westlichen Provinzteilen sind kleinere, von Kreisgräben
eingefasste Grabhügel zwar nicht unbekannt (z. B. Kempten, Oberpeiching), kommen
dort aber im Gegensatz zum Osten eher sporadisch vor.
Auch bei schlechter Oberflächenerhaltung lässt sich das Vorhandensein ehemaliger Hügel von bis zu 7-8 m Dm durch die weiten Abstände zwischen den Gräbern nachvollziehen.
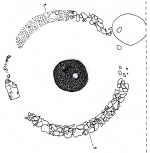 Im
Mittelabschnitt der aus insgesamt 91 Gräbern bestehenden Nekropole von Ergolding
(Ldkr. Landshut) wird der mit 4,7 m Dm größte Grabhügel um Grab 50 von einem
Steinkranz umringt (Struck 1996, 183). Da diese Steinsetzung auf Kiesfundament
kaum die Tragfähigkeit eines veritablen tumulus-Tambours hatte, ist
sie eher als niedriges, trocken gesetztes Umfassungsmäuerchen zu betrachten.
Im
Mittelabschnitt der aus insgesamt 91 Gräbern bestehenden Nekropole von Ergolding
(Ldkr. Landshut) wird der mit 4,7 m Dm größte Grabhügel um Grab 50 von einem
Steinkranz umringt (Struck 1996, 183). Da diese Steinsetzung auf Kiesfundament
kaum die Tragfähigkeit eines veritablen tumulus-Tambours hatte, ist
sie eher als niedriges, trocken gesetztes Umfassungsmäuerchen zu betrachten.
 Diese
Ausbauphase unter Verwendung von Stein datiert schon in das späte 2. oder frühe
3. Jahrhundert. Gleichwohl möchte man annehmen, dass die Präferenz für Grabhügel,
gleich ob als Nachbestattungen oder Neuanlagen, durch römische tumuli
angeregt wurde. Aus einer einheimisch-vorrömischen Tradition lässt sie sich
jedenfalls nicht sicher ableiten, obwohl Grabhügel der spätesten Eisenzeit (LT
D2) in Hörgertshausen (Ldkr. Freising) entdeckt wurden. Deren rechteckige Pfostengräbchen
werden jedenfalls als Wandabstützung eines Hügels rekonstruiert. Nach den Beigaben
zu urteilen, standen die so bestatteten Menschen in Kontakt mit „germanischer“
Kultur jenseits der Donau (Gebhard 2004).
Diese
Ausbauphase unter Verwendung von Stein datiert schon in das späte 2. oder frühe
3. Jahrhundert. Gleichwohl möchte man annehmen, dass die Präferenz für Grabhügel,
gleich ob als Nachbestattungen oder Neuanlagen, durch römische tumuli
angeregt wurde. Aus einer einheimisch-vorrömischen Tradition lässt sie sich
jedenfalls nicht sicher ableiten, obwohl Grabhügel der spätesten Eisenzeit (LT
D2) in Hörgertshausen (Ldkr. Freising) entdeckt wurden. Deren rechteckige Pfostengräbchen
werden jedenfalls als Wandabstützung eines Hügels rekonstruiert. Nach den Beigaben
zu urteilen, standen die so bestatteten Menschen in Kontakt mit „germanischer“
Kultur jenseits der Donau (Gebhard 2004).
Diese (Nach-) Bestattungssitte in bzw. unter Hügeln pflegte auch die sog. „Heimstettener Gruppe“, die sich im oberbayerisch-schwäbischen Voralpengebiet ca. 30-60 n. Chr. durch Körperbestattungen mit eigenwilliger Trachtbeigabe in den Frauengräber und Waffenbeigabe in Männergräbern definiert (Keller 1984). Die kontroverse Diskussion über die Herkunft dieser Menschen – Einheimische oder umgesiedelte Bevölkerung aus den Zentralalpen („Räter“) – dauert an. Es wurde auch vorgeschlagen, diese Bevölkerung mit angesiedelten Veteranen der ersten Rekrutierungswelle der Räter- und Vindelikerkohorten zu identifizieren. Ein wesentliches Argument dafür lieferte das Inventar eines Männergrabes mit cingulum-Schnalle unter einem Grabhügel von 5 m Dm an der via publica Augusta Vindelicum/Augsburg – Iuvavum/Salzburg bei München-Feldmoching (Mackensen 1987, 159 f.).
Erst ab der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts setzte sich in diesem Kulturkreis
die Brandbestattung durch. Mit ihr ging die Übernahme weiterer Versatzstücke
italisch-römischer Grabkultur einher. So wurde beispielsweise im Gräberfeld
von Niedererlbach ein hölzerner Schacht freigelegt, der der Trankopferspende
diente (Faber/Koch 2004, 96). Das Beigabenspektrum umfasst – soweit publiziert
– aber auch noch um 200 n. Chr. aus gallischen Wurzeln entsprossene Elemente:
dazu gehört ein bronzener Adleraufsatz eines Reisewagens (Christlein/Weber 1980),
der offensichtlich als pars pro toto-Beigabe zu interpretieren ist. Hier ist
zweifellos der Einfluss norisch-pannonischer Wagengräber spürbar. Im Treverergebiet
hingegen wurden Ausfahrten mit dem Wagen als Zeichen hohen Sozialprestiges stattdessen
auf Reliefs abgebildet (Freigang 1997, 327-330; Kossak 2000).
Der Grabbau hingegen hat kaum Veränderungen erfahren wie übrigens auch der konstant
hölzerne Siedlungsbau nicht. Das weitgehende Fehlen von Steinarchitektur – von
einer der bisher wenigen Ausnahmen (Niedererlbach) wird weiter unten noch zu
sprechen sein – entspricht den bis ins 3. Jahrhundert fast ausschließlich in
Holz-Erde-Technik errichteten Siedlungen. Die meist kleinen Grabgruppen reihen
sich an den römischen Fernstraßen auf und gehörten als Familienfriedhöfe in
aller Regel zu Einzelhofsiedlungen.
Diese römerzeitliche Grabhügelsitte setzt sich in ganz ähnlicher Weise jenseits
des Inns im westlichen Noricum fort. Dort befestigte man den Hügelfuß öfter
mit einer Rollsteindecke. Manche von ihnen haben flache, rechteckig oder rund
angelegte Grabkammern aus gesetzten Steinen. Sie waren nicht begehbar und dienten
nur der Aufnahme der Urne und der Beigaben. Die größeren unter ihnen können
bei schlechter Oberflächenerhaltung auch wie Fundamente kleiner Grabkapellen
aussehen.
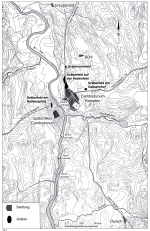 Die
nächste „Generation“ von Grabbauten, die über die Beigaben zugehöriger Gräber
datiert werden kann, lässt sich erst wieder um 100 n. Chr. fassen. Monströse steinerne
Grabbauten bleiben auch im 2. Jahrhundert weitgehend auf die größeren städtischen
Siedlungen und deren Umfeld (Kempten, Augsburg, Epfach und ab dem späten 2. Jahrhundert
Regensburg), die Donauufer und das Limesgebiet beschränkt. Fast immer liegen die
Monumente an den großen Fernstraßen und Verkehrsknotenpunkten, so z. B. im Bereich
der Donauübergänge bei Donauwörth (IRB 226; Czysz 1999, 52) und Neuburg. Manches
Vicus-Gräberfeld im Voralpenland ist hingegen nie durch einen Grabbau, nicht einmal
in Form von Einfriedungen bereichert worden, so z. B. nicht die aus immerhin 251
Gräbern bestehende Nekropole von Schwabmünchen. Das liegt sicherlich am bescheidenen
Lebensniveau des Töpfervicus und, damit einhergehend, an der mangelnden Verfügbarkeit
geeigneter, zu importierender Bausteine, was sich genauso im fehlenden Steinausbau
der Siedlungen selbst niederschlägt.
Die
nächste „Generation“ von Grabbauten, die über die Beigaben zugehöriger Gräber
datiert werden kann, lässt sich erst wieder um 100 n. Chr. fassen. Monströse steinerne
Grabbauten bleiben auch im 2. Jahrhundert weitgehend auf die größeren städtischen
Siedlungen und deren Umfeld (Kempten, Augsburg, Epfach und ab dem späten 2. Jahrhundert
Regensburg), die Donauufer und das Limesgebiet beschränkt. Fast immer liegen die
Monumente an den großen Fernstraßen und Verkehrsknotenpunkten, so z. B. im Bereich
der Donauübergänge bei Donauwörth (IRB 226; Czysz 1999, 52) und Neuburg. Manches
Vicus-Gräberfeld im Voralpenland ist hingegen nie durch einen Grabbau, nicht einmal
in Form von Einfriedungen bereichert worden, so z. B. nicht die aus immerhin 251
Gräbern bestehende Nekropole von Schwabmünchen. Das liegt sicherlich am bescheidenen
Lebensniveau des Töpfervicus und, damit einhergehend, an der mangelnden Verfügbarkeit
geeigneter, zu importierender Bausteine, was sich genauso im fehlenden Steinausbau
der Siedlungen selbst niederschlägt.  Obwohl
der Statthaltersitz zu diesem Zeitpunkt bereits nach Augsburg verlegt worden war,
und Cambodunum in seiner städtischen Entwicklung stagnierte, sind in seinem Umfeld
noch immer einzelne Zeugnisse prachtvoller Grabarchitektur fassbar. In diese Kategorie
fällt ein massiver, 5 x 5 m großer Fundamentkörper aus mehreren Steinlagen an
der Kaufbeurer Straße, der rund 600 m nördlich der Siedlungsgrenze von Cambodunum
freigelegt wurde. Auf einem flachem Höhenrücken an einer Abzweigung von der Fernstraße
Kempten – Augsburg zur römischen Siedlung „Bühl“ gelegen, dürfte der hier einst
gestandene Grabbau ein weithin sichtbares Geländemerkmal gebildet haben.
Obwohl
der Statthaltersitz zu diesem Zeitpunkt bereits nach Augsburg verlegt worden war,
und Cambodunum in seiner städtischen Entwicklung stagnierte, sind in seinem Umfeld
noch immer einzelne Zeugnisse prachtvoller Grabarchitektur fassbar. In diese Kategorie
fällt ein massiver, 5 x 5 m großer Fundamentkörper aus mehreren Steinlagen an
der Kaufbeurer Straße, der rund 600 m nördlich der Siedlungsgrenze von Cambodunum
freigelegt wurde. Auf einem flachem Höhenrücken an einer Abzweigung von der Fernstraße
Kempten – Augsburg zur römischen Siedlung „Bühl“ gelegen, dürfte der hier einst
gestandene Grabbau ein weithin sichtbares Geländemerkmal gebildet haben.
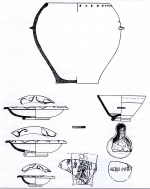 Unmittelbar
an die Rückseite des Fundaments lehnte sich ein Urnengrab an, das kaum anders
denn als das Gründergrab dieses (Familien-?) Monuments zu interpretieren ist.
Gleichartige Befundkonstellationen werden im Kapitel Grabbauten in Niedergermanien
besprochen, worauf hier verwiesen sei. Die Beigaben ermöglichen eine Datierung
von Grab und Grabbau in die Jahre um 100 n. Chr.
Unmittelbar
an die Rückseite des Fundaments lehnte sich ein Urnengrab an, das kaum anders
denn als das Gründergrab dieses (Familien-?) Monuments zu interpretieren ist.
Gleichartige Befundkonstellationen werden im Kapitel Grabbauten in Niedergermanien
besprochen, worauf hier verwiesen sei. Die Beigaben ermöglichen eine Datierung
von Grab und Grabbau in die Jahre um 100 n. Chr.
Da keine Architekturreste gefunden wurden, lässt sich über das Aussehen des
Monuments leider nur spekulieren. Nach dem Vorbild ähnlich konstruierter und
dimensionierter Grabbaufundamente in den germanischen Provinzen sowie in der
Gallia Belgica ist es gut vorstellbar, dass hier ein Mausoleum vom Typ des Kölner
Poblicius-Grabmals stand. Ein Pfeilergrabmal ist zwar nicht ausgeschlossen,
doch würde es sich dann um den frühesten Vertreter dieses Denkmaltyps in der
Provinz handeln.
 Dass
in der Umgebung von Kempten während des frühen 2. Jahrhunderts mit luxuriösen
Grabbauten zu rechnen ist, dokumentiert noch ein anderer Fund: rund 50 km nördlich
von Kempten, ebenfalls an der Iller, liegt die spätantike Festung Caelius Mons/Kellmünz.
In ihren Mauern fand man mehrere Torsi lebensgroßer Gewandstatuen sekundär verbaut,
die ursprünglich sehr wahrscheinlich als Grabstatuen im tempelartigen Aufbau
eines (oder sogar verschiedener?) Mausoleums oder aber in einem Grabtempel ohne
Sockelgeschoss gestanden hatten. Bei den vier weiblichen Gewandstatuen und einer
Togastatue (CSIR I, 1 Nr. 181-185) handelt es sich mit einer Ausnahme um äußerst
qualitätvolle Skulpturen aus Südtiroler Marmor, deren Anspruch dem italischer
Kunstwerke kaum nachsteht.
Dass
in der Umgebung von Kempten während des frühen 2. Jahrhunderts mit luxuriösen
Grabbauten zu rechnen ist, dokumentiert noch ein anderer Fund: rund 50 km nördlich
von Kempten, ebenfalls an der Iller, liegt die spätantike Festung Caelius Mons/Kellmünz.
In ihren Mauern fand man mehrere Torsi lebensgroßer Gewandstatuen sekundär verbaut,
die ursprünglich sehr wahrscheinlich als Grabstatuen im tempelartigen Aufbau
eines (oder sogar verschiedener?) Mausoleums oder aber in einem Grabtempel ohne
Sockelgeschoss gestanden hatten. Bei den vier weiblichen Gewandstatuen und einer
Togastatue (CSIR I, 1 Nr. 181-185) handelt es sich mit einer Ausnahme um äußerst
qualitätvolle Skulpturen aus Südtiroler Marmor, deren Anspruch dem italischer
Kunstwerke kaum nachsteht.
Es erscheint vielmehr die Annahme berechtigt, dass die Plastiken aus Italien importiert wurden. Darauf deutet beispielsweise der weibliche Torso mit hoher Gürtung und geknüpften Ärmel hin, dessen Vorbild unter hellenistischen Gewandstatuen zu suchen ist. |
Auch die Darstellung einer vornehmen Dame mit Schoßhündchen bleibt in Rätien einstweilen singulär. |
Den oder die Stifter dieser Statuen sollte man unter den politisch wie wirtschaftlich
einflussreichen Familien von Cambodunum suchen. Die demonstrative Zurschaustellung
der römischen toga war, so möchte man annehmen, durch den rechtlichen
Status als römischer Bürger legitimiert. Wo die Skulpturen aufgestellt waren,
lässt sich nicht ohne weiteres rekonstruieren. In Frage käme ein Mausoleum wie
das an der Kaufbeurer Straße erschlossene. Zusammen mit den Torsi wurden zwei
ebenfalls marmorne Porträtbüsten (CSIR I, 1 Nr. 186-187) gefunden, für die ein
Sepulkralkontext kaum zu bestreiten ist. Sollte auch der ursprüngliche Aufstellungsort
eine gemeinsamer gewesen sein, so müsste man wohl eher an einen begehbaren Grabtempel
ohne Sockelgeschoss oder an ein columbarium denken. Ein dafür theoretisch
passender Gebäudegrundriss befindet sich im nördlichen Abschnitt der Gräberstraße
„Keckwiese“, der durch die Überschneidung von älteren Gräbern ebenfalls in das
2. Jahrhundert datiert ist (Faber 1998, 166 f.). Allerdings ist nicht sicher,
ob dieser langrechteckige Bau mit Vorkammer überdacht war, was für einen Aufstellungsort
von Statuen freilich zu fordern wäre. Begehbare unterirdische Grabkammern wie
am Niederrhein oder in der Gallia Belgica, die ebenfalls für die Aufnahme von
Büsten in Betracht kommen (z. B. Köln-Weiden), fehlen im Arbeitsgebiet.
Unbeantwortet bleibt einstweilen auch die Frage, ob die Statuen um 300 n. Chr.
direkt aus Kempten verschleppt wurden. Alternativ dazu wird der ursprüngliche
Platz der Statuen im Grabbezirk einer reichen Landvilla nahe Kellmünz erwogen.
Ein adäquater Siedlungsbefund wurde dort bisher allerdings noch nicht lokalisiert.
Dafür dass sich Angehörige der städtischen Oberschicht bevorzugt bei ihren Landsitzen
bestatten ließen, lassen sich Beispiele aus dem Raum Augsburg anführen, z. B.
Stadtbergen und Wehringen (s. u.). Anhand kunstgeschichtlicher Kriterien werden
die Skulpturen von Kellmünz in das frühe 2. Jahrhundert gesetzt; ein älterer
Datierungsansatz gilt als unwahrscheinlich.
 Zumindest
im nördlichen Rätien hat man Mausoleen noch während des 2. Jahrhunderts errichtet,
während sie im Rheinland bereits ab flavischer Zeit von den Pfeilergrabmälern
verdrängt wurden. Seit fast 100 Jahren schon kennt man das Fragment einer Toga-Statue,
zwei Architravbruchstücke sowie ein Antenkapitell im ionisch-korinthischen Kompositstil
aus Großsorheim bei Harburg im südlichen Nördlinger Ries (Wagner 1973 Nr. 214-216).
Im Jahre 2006 konnte das Mausoleumfundament schließlich freigelegt werden.
Zumindest
im nördlichen Rätien hat man Mausoleen noch während des 2. Jahrhunderts errichtet,
während sie im Rheinland bereits ab flavischer Zeit von den Pfeilergrabmälern
verdrängt wurden. Seit fast 100 Jahren schon kennt man das Fragment einer Toga-Statue,
zwei Architravbruchstücke sowie ein Antenkapitell im ionisch-korinthischen Kompositstil
aus Großsorheim bei Harburg im südlichen Nördlinger Ries (Wagner 1973 Nr. 214-216).
Im Jahre 2006 konnte das Mausoleumfundament schließlich freigelegt werden.
 Eine
bis auf Kopf und Unterarme erhaltene Toga-Statue wurde in Nassenfels (Ldkr.
Eichstätt), im Bereich des Gräberfeldes an der Ausfallstraße nach Kösching in
sekundärer Fundlage entdeckt (CSIR I, 1 Nr. 231). Die dortige Nikolauskapelle
steht auf den Fundamenten eines (größeren) römischen Grabbaus, vielleicht eines
Mausoleums. Etliche weitere Bruchstücke steinerner Porträtstatuen liegen aus
verschiedenen Fundorten vor, z. B. aus Augsburg (CSIR I, 1 Nr. 76), Hitzhofen
(Ldkr. Eichstätt, wohl aus Pfünz verschleppt: CSIR I, 1 Nr. 225) oder Rennertshofen
(Ldkr. Neuburg-Schrobenhausen, Rieder 1984). Aufgrund unbekannter oder sekundärer
Fundkontexte kann in diesen Fällen allerdings nicht zweifelsfrei zwischen Grab-
oder öffentlich aufgestellten Ehrenstatuen unterschieden werden.
Eine
bis auf Kopf und Unterarme erhaltene Toga-Statue wurde in Nassenfels (Ldkr.
Eichstätt), im Bereich des Gräberfeldes an der Ausfallstraße nach Kösching in
sekundärer Fundlage entdeckt (CSIR I, 1 Nr. 231). Die dortige Nikolauskapelle
steht auf den Fundamenten eines (größeren) römischen Grabbaus, vielleicht eines
Mausoleums. Etliche weitere Bruchstücke steinerner Porträtstatuen liegen aus
verschiedenen Fundorten vor, z. B. aus Augsburg (CSIR I, 1 Nr. 76), Hitzhofen
(Ldkr. Eichstätt, wohl aus Pfünz verschleppt: CSIR I, 1 Nr. 225) oder Rennertshofen
(Ldkr. Neuburg-Schrobenhausen, Rieder 1984). Aufgrund unbekannter oder sekundärer
Fundkontexte kann in diesen Fällen allerdings nicht zweifelsfrei zwischen Grab-
oder öffentlich aufgestellten Ehrenstatuen unterschieden werden.
Ein Zusammenhang zwischen Fund und Befund erscheint möglich, ist aber nicht
verifiziert.
Ein repräsentatives Bauwerk trug auch die wuchtige, aus Steinblöcken gesetzte
Fundamentbasis oberhalb von Kastell und Vicus Aalen (Ostalbkreis). Da weder
Gräber noch Architekturteile überliefert sind, ist die Deutung des Bauwerks
jedoch umstritten. Wegen seiner exponierten Hanglage an der Kreuzung von Rems-
und Kochertal errichtet kommt am ehesten ein Grabmal oder ein Ehrenmonument
in Betracht (Luik 1994, 269-271).
Eine durch die Zahl an Architekturteilen herausragende, im ganzen nördlichen
Provinzgebiet verbreitete – im alpinen Rätien bisher aber nicht nachgewiesene
– Grabmalgattung sind Pfeilergrabmäler vom Typ der sog. „Igeler Säule“ bei Trier
(Gauer 1978). Im Unterschied zu dieser, die 23 m hoch aufragt, und zu entsprechenden
Denkmälern in den Rheinprovinzen sind die rätischen jedoch erheblich kleiner
und erreichen Höhen von maximal 10-11, meist nur 4-7 m. Aus Augsburg liegen
mittlerweile zwei fast vollständig erhaltene Pfeilergrabmäler vor, die an der
Gräberstraße nördlich der Stadt standen. Durch ein Hochwasser der Wertach zum
Einsturz gebracht und verschüttet, wurden die Blöcke und Architekturteile teilweise
noch in Versturzlage beim Kiesabbau wiederentdeckt. Es handelt sich um die monumentalen
Kennzeichnungen der Familiengräber des Titus Flavius Martialis (IBR 123), über
dessen gesellschaftliche Stellung und Beruf die Grabinschrift leider schweigt,
sowie des Kaiserkultpriesters (sevir Augustalis) und – wie er selbst
betont – freigeborenen Rechtsgelehrten (pragmaticus) Marcus Aurelius
Carus (Bakker 1998).
 Die
Pfeilerdenkmäler waren in der Regel aus sechs oder sieben skulptierten Kalksteinblöcken
zusammengesetzt, die miteinander durch Bleiklammern verdübelt zu werden pflegten.
Der 7 m hohe Carus-Pfeiler als bislang größtes bekanntes Augsburger Exemplar
bestand aus neun Architekturteilen. Ihre Fundamente bildeten in der Regel solide,
tiefreichende Gussmauerblöcke, wie man sie beispielsweise im östlichen Gräberfeld
von Faimingen freigelegt hat (Fasold/Weber 1985, 198; Fasold/Hüssen 1985, 293).
Ein 4 x 4 m großes Grabbaufundament in Sontheim/Brenz soll einen mindestens
8 m hohen Aufbau getragen haben. Seine 1 m starken Grundmauern reichten mehr
als 1,1 m in die Tiefe (Hagendorn/Nuber/Scheuerbrandt 1993, 199).
Die
Pfeilerdenkmäler waren in der Regel aus sechs oder sieben skulptierten Kalksteinblöcken
zusammengesetzt, die miteinander durch Bleiklammern verdübelt zu werden pflegten.
Der 7 m hohe Carus-Pfeiler als bislang größtes bekanntes Augsburger Exemplar
bestand aus neun Architekturteilen. Ihre Fundamente bildeten in der Regel solide,
tiefreichende Gussmauerblöcke, wie man sie beispielsweise im östlichen Gräberfeld
von Faimingen freigelegt hat (Fasold/Weber 1985, 198; Fasold/Hüssen 1985, 293).
Ein 4 x 4 m großes Grabbaufundament in Sontheim/Brenz soll einen mindestens
8 m hohen Aufbau getragen haben. Seine 1 m starken Grundmauern reichten mehr
als 1,1 m in die Tiefe (Hagendorn/Nuber/Scheuerbrandt 1993, 199).
Der Kalkstein für die reliefgeschmückten Bauglieder wurde mehrheitlich von der
Schwäbischen Alb herbeigeschafft. Daneben zeigen Relief- und Inschriftenplatten
an, dass auch mit gemauerten Pfeilerkörpern zu rechnen ist, die außen verblendet
waren. Diese Lösung war nicht nur logistisch vorteilhafter, sondern gewiss auch
preiswerter. Stiche aus dem 18. Jahrhundert scheinen die Rümpfe solcher aus
Ziegeln (?) gemauerter Pfeiler wiederzugeben. Sie standen damals wohl noch teilweise
aufrecht, weil ihre Substanz als Baustoffquelle weniger begehrt war als die
Kalksteinplatten ihrer Verkleidung (Bakker 1985, 204 f.). Als Beispiele dafür
dürfen möglicherweise ein „Hirtenrelief“ aus Epfach in Anspruch genommen werden
sowie ein mit passenden Dübellöchern versehenes Delphinrelief – Delphine galten
als Boten der Unterwelt – aus Passau.
Die eigentlichen Gräber sind entweder neben diesen Bauten zu suchen oder –
archäologisch dann nicht mehr nachweisbar – in einst vielleicht vorhandenen
Nischen im Denkmalkörper.
In Augsburg und seinem Umland kamen bisher die meisten Vertreter des Grabmaltyps
zum Vorschein – es liegen Spolien von rund 30 verschiedenen Pfeilern vor. Als
charakteristisch für die (west-) rätischen Grabpfeiler kristallisieren sich
Bekrönungen mit einem kubischen Kapitell korinthischer Ordnung, in exklusiverer
Variante mit einem sog. „Jahreszeitenkapitell“ (Schromm 2003) heraus, das einen
steinernen Pinienzapfen trägt. Letztere müssen im Mittelalter und der frühen
Neuzeit in Augsburg noch derartig häufig sichtbar gewesen sein, dass sie Eingang
in das Augsburger Stadtwappen fanden. Da diese Aufsatzsteine sich zur zweckfremden
Vermauerung in späterer Zeit kaum eigneten, blieben sie nach der Demontage des
zugehörigen Denkmals oft an dessen Standort liegen. Auf diese Weise erteilt
ihr Vorkommen dem Archäologen noch heute Auskunft über die Verbreitung von Pfeilergrabmälern,
deren Abschluss sie in der Regel bildeten (bisweilen aber vielleicht auch von
tumuli). So lassen mehrere Pinienzapfen im Umfeld der Kastelle Heidenheim
und Aalen einen gewissen Zusammenhang zwischen Grabbau und den dort lebenden
Familien von Veteranen der ala II Flavia milliaria, der bis um 170/80
n. Chr. stärksten und ranghöchsten Einheit der Provinz, erahnen. Ein rund 1
m hoher Kalkstein-Pinienzapfen von der Albhochfläche bei Heidenheim-Großkuchen
(„Härtsfeld“), der in der Völkerwanderungszeit sekundäre Verwendung als Schmiedeamboss
fand, bezeugt wohl einen bislang nicht lokalisierten Gutshof in dieser als unwirtlich
geltenden Region.

 Ein
weiterer Verbreitungsschwerpunkt konzentriert sich auf Castra Regina/Regensburg.
Dort sind Reste von mindestens vier Pfeilern bekannt, die nach den mythologischen
Darstellungen ihrer erhaltenen Reliefpartien als „Aiaxpfeiler“, „Aegispfeiler“,
„Hercules-Alkestis-Pfeiler“ und „Totenmahl-Pfeiler“ benannt werden. Für die
beiden zuerst genannten wurde eine Gesamthöhe von 10-11 m errechnet. Wichtige
Hinweise für die Höhenbestimmung liefern die Größen der Relieffiguren im Obergeschoss,
aus denen sich die Gesamtproportionen annähernd erschließen lassen (Gauer 1978,
79; Schmidts 2003, 84).
Ein
weiterer Verbreitungsschwerpunkt konzentriert sich auf Castra Regina/Regensburg.
Dort sind Reste von mindestens vier Pfeilern bekannt, die nach den mythologischen
Darstellungen ihrer erhaltenen Reliefpartien als „Aiaxpfeiler“, „Aegispfeiler“,
„Hercules-Alkestis-Pfeiler“ und „Totenmahl-Pfeiler“ benannt werden. Für die
beiden zuerst genannten wurde eine Gesamthöhe von 10-11 m errechnet. Wichtige
Hinweise für die Höhenbestimmung liefern die Größen der Relieffiguren im Obergeschoss,
aus denen sich die Gesamtproportionen annähernd erschließen lassen (Gauer 1978,
79; Schmidts 2003, 84).
Ursprungs- und Hauptverbreitungsgebiet dieser Grabmalform ist das Moselland.
Zu Recht wird angenommen, dass die Kenntnis der Grabpfeiler durch treverische
Händler übernommen wurde, die in Augsburg und Regensburg ansässig waren und
vermutlich vom Italienhandel profitierten (Gauer 1978, 88). Ein solcher dürfte
z. B. der Treverer Sextus Attonius Privatus gewesen sein, der das Amt eines
sevir Augustalis bekleidete und in Augsburg eine Tempelrenovierung stiftete
(IBR 108). Die vermutete „Initialzündung“ durch das importierte Vorbild einzelner
Einwanderer aus der Gallia Belgica gewinnt auch dadurch an Gewicht, dass das
südliche Obergermanien im Verbreitungsgebiet regelrecht „übersprungen“ wird
und daher keine kontinuierliche Ausbreitung stattgefunden haben kann. In Noricum
dünnen Grabpfeiler merklich aus (Kremer 2001, 352-356).
 Eine
weitere Grabbaugattung, deren Vorkommen sich innerhalb Rätiens bisher ebenfalls
auf Augsburg beschränkt, stellen Nischengrabmäler dar (CSIR I, 1 Nr. 18-21).
Für sie sind überdimensionierte Stelen auf einer Basis charakteristisch, deren
Reliefs Ehepaare annähernd in Lebensgröße zeigen. Wie die Pfeilergrabmäler dürften
auch sie aus der Gallia Belgica vermittelt worden sein.
Eine
weitere Grabbaugattung, deren Vorkommen sich innerhalb Rätiens bisher ebenfalls
auf Augsburg beschränkt, stellen Nischengrabmäler dar (CSIR I, 1 Nr. 18-21).
Für sie sind überdimensionierte Stelen auf einer Basis charakteristisch, deren
Reliefs Ehepaare annähernd in Lebensgröße zeigen. Wie die Pfeilergrabmäler dürften
auch sie aus der Gallia Belgica vermittelt worden sein.
Bei der Lektüre der Augsburger Grabbauinschriften (gleich welchen Bautyps)
fällt zunächst auf, dass wir es stets mit Trägern zwei- oder dreiteiliger Namen
zu tun haben, mehrheitlich wohl mit römischen Bürgern. Schaut man – soweit erwähnt
– auf die Berufe und gesellschaftlichen Stellungen der Genannten, so findet
man: zwei Kaiserpriester (seviri Augustales), von denen der bereits
genannte Carus ausdrücklich betont, kein Freigelassener, sondern Freigeborener
(ingenuus) gewesen zu sein, drei während der Dienstzeit verstorbene
Soldaten und Unteroffiziere der Regensburger Legion (legio III Italica,
IBR 123; 125; Bakker 1984, 112), einen Legionsveteranen und einen Kavallerieoffizier
(IBR 129; 134). Weiterhin verraten der Textilhändler (negotiator vestiarius,
IBR 127) Iulius Victor, der Weinhändler Pompeianius Silvius (Bakker 1985a) sowie
der Purpurhändler (negotiator artis purpurariae) und sevir
Tiberius Claudius Euphras zugleich die Quelle ihres durch die Grabdenkmäler
zur Schau gestellten Reichtums. Die zuletzt erwähnte Grabinschrift des Purpurhändlers
und seiner Frau Senilia Lasciva gilt übrigens als der älteste verbürgte Bodenfund
Bayerns, ist aber leider nur durch eine Abschrift und geradezu lapidare Beschreibung
aus dem 15. Jahrhundert überliefert (IBR 135). Den Reigen beschließt der Freigelassene
Publius Frontinius Decoratus, der um 200 n. Chr. als Beauftragter einer Pächtergesellschaft
von Ertragsabgaben aus den Eisenbergwerken (manceps ferrariarum) Rätiens
und der drei dakischen Provinzen wirkte (Nuber 1985). Die moderne Umschreibung
seines Jobs klingt bürokratisch, doch muss dieser lukrativ gewesen. Sein reliefgeschmückter
Sarkophag bezeugt zumindest indirekt einen Grabbau (Grabtempel?), in dem dieser
aufgestellt gewesen sein dürfte.
In der Zusammenschau bleibt also zu konstatieren, dass wir hier offenkundig
nur die „zweite Reihe“ der Oberschicht des municipium Augsburg erfassen,
aber dafür eine zumindest wirtschaftlich erfolgreiche. Diesen Sachverhalt bringen
ferner die berufsbezogenen, wohlbekannten Grabreliefs aus Augsburg klar zum
Ausdruck.
Mit wenigen Ausnahmen (z. B. Bakker 1985b, 97) hat sich die politische Elite des ordo decurionum wohl bevorzugt bei ihren „Sommerresidenzen“ im Umland der Stadt beisetzen lassen. Zu nennen sind die Inschriften der decuriones municipi Aelii Augusti:
Caius Iulianius Iulius aus Biberbach, 18 km nördlich von Augsburg gelegen (IBR 136);
Publius (?) Iulius Pintamus, eines Spaniers aus Bracaraugusta im heutigen Portugal, der es in seiner vormaligen militärischen Laufbahn zum Reiteroffizier (decurio alae) gebracht hatte und schließlich bei Leutstetten am nördlichen Starnberger See seine letzte Ruhe fand (Radnoti 1972) und
Marcus Titius Patruelis, von Hause aus Gallier aus der civitas Sequanorum (heute nordwestliches Burgund bis Westschweiz), dessen titulus in der Kirche von Gundremmingen an der Donau (Ldkr. Günzburg) vermauert war (Dietz/Weber 1982, 411).
Auch der titulus des Flavius Vettius Titus, eines Beamten der provinzialen Steuerkasse (advocatus fisci Raetici, IBR 176) kam 8 km westlich der Stadt bei Derching zutage. Auf den Sonderfall der Wehringer Grablegen wird weiter unten einzugehen sein.

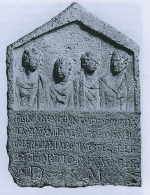 Die
Markomannenkriege brachten für die Provinz einschneidende Veränderungen, denn
im neu gegründeten Legionslager Regensburg wurde spätestens 179 n. Chr. die
legio III Italica stationiert. Dadurch wurde Rätien um eine weitere
Metropole neben Augsburg bereichert. Bezüglich des Grabbaus jedenfalls hatte
diese Region bis dahin keine Rolle gespielt. Natürlich drängt sich nun die Frage
auf, welche Neuerungen die der Überlieferung nach in Italien ausgehobenen Rekruten
an die Donau brachten. Allzu augenfällige Innovationen – dies sei gleich vorweggenommen
– erblühten daraus nicht, anders als etwa am Rhein im frühen 1. Jahrhundert.
In Italien selbst war die Manie monumentale Grabdenkmäler zu errichten im späten
2. Jahrhundert bereits stark abgeflaut. Eine von den Legionären mitgebrachte
Neuerung sind sicherlich die Grabstelen mit Giebel und Porträtfries, in dem
die inschriftlich genannten Personen nebeneinander als Büsten oder Halbfiguren
abgebildet werden (Kockel 1993).
Die
Markomannenkriege brachten für die Provinz einschneidende Veränderungen, denn
im neu gegründeten Legionslager Regensburg wurde spätestens 179 n. Chr. die
legio III Italica stationiert. Dadurch wurde Rätien um eine weitere
Metropole neben Augsburg bereichert. Bezüglich des Grabbaus jedenfalls hatte
diese Region bis dahin keine Rolle gespielt. Natürlich drängt sich nun die Frage
auf, welche Neuerungen die der Überlieferung nach in Italien ausgehobenen Rekruten
an die Donau brachten. Allzu augenfällige Innovationen – dies sei gleich vorweggenommen
– erblühten daraus nicht, anders als etwa am Rhein im frühen 1. Jahrhundert.
In Italien selbst war die Manie monumentale Grabdenkmäler zu errichten im späten
2. Jahrhundert bereits stark abgeflaut. Eine von den Legionären mitgebrachte
Neuerung sind sicherlich die Grabstelen mit Giebel und Porträtfries, in dem
die inschriftlich genannten Personen nebeneinander als Büsten oder Halbfiguren
abgebildet werden (Kockel 1993).

 Die
Erinnerung an italische Grabbauten mit solchen Porträtfriesen mögen diese Stelenvariante
durchaus inspiriert haben. Demgegenüber werden die verstorbenen Familienmitglieder
auf den Obergeschossblöcken der Augsburger Grabpfeiler zwar auch nebeneinander,
aber als Vollfiguren abgebildet. Dort wirkte sich eher der Einfluss gallischer
Nischengrabmäler aus.
Die
Erinnerung an italische Grabbauten mit solchen Porträtfriesen mögen diese Stelenvariante
durchaus inspiriert haben. Demgegenüber werden die verstorbenen Familienmitglieder
auf den Obergeschossblöcken der Augsburger Grabpfeiler zwar auch nebeneinander,
aber als Vollfiguren abgebildet. Dort wirkte sich eher der Einfluss gallischer
Nischengrabmäler aus.
Ob auch die eigenartigen Baustilkombinationen der Wehringer Monumente um 200 n. Chr. (s. u.) vielleicht durch den Kontakt mit Soldaten der ersten Generation der legio III Italica angeregt wurden, wäre gewiss schon zuviel der Spekulation. Es gibt dafür keine positiven Anzeichen. Aufgrund der enormen Wirtschaftskraft der Legion ist aber unmissverständlich eine quantitative Zunahme bereits etablierter Grabbautypen, insbesondere von Grabpfeilern und Grabaltären, zu verzeichnen. Streng genommen könnte man sogar so weit gehen, dass Grabpfeiler in der Provinz insgesamt nicht sicher vor 170/80 n. Chr. datiert werden können. Das gilt auch für die Augsburger Pfeiler, deren Ursprung aber wie gesagt wohl auf gallische Einwanderer, kaum auf Legionäre zurückgeht. Ähnlich verhält es sich mit Grabaltären, die in Rätien vor dem Eintreffen der Legion zwar bekannt waren, die aber besonders nach 180 n. Chr., wahrscheinlich sogar erst in der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts an Menge (und Größe?) zunehmen. Es fällt auf, dass mehrere von ihnen von Menschen griechischsprachiger Provenienz gesetzt wurden. Dieses Phänomen ist auch bei den niedergermanischen Grabaltären zu beobachten.

 Fraglos
hat die Legion den Zentren der Provinz einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert,
der sich auch im Grabbau ausdrückt. Gleichwohl offenbaren sich erkennbare Tendenzunterschiede
zwischen den Metropolen Augsburg und Regensburg. Während aus den Arealen der
Regensburger Gräberfelder zahlreiche Architekturteile von Grabbauten vorliegen
(v. Schurbein 1977, 253-259), fehlen sie im Umland von Castra Regina fast gänzlich.
Die Oberschicht der Regensburger canabae muss also weitgehend vor Ort
bestattet worden sein, d. h. sie blieb standortbezogen (Schmidts 2003, 87).
Ein weiterer Unterschied manifestiert sich in der Vorliebe für bestimmte Bildprogramme.
Augenfällig wird dies natürlich durch militärische Themen auf Regensburger Reliefs,
wie z. B. die „Pferdevorführung“ CSIR I, 1 Nr. 386, die auf rheinischen Reitergrabsteinen
in flavischer Zeit begegnet und um 200 n. Chr. schon „veraltet“ war. Auf den
Grabstelen der stadtrömischen Gardereiter (equites singulares) hielten
sich Varianten dieser Repräsentationsform der Kavalleristen dagegen länger.
Fraglos
hat die Legion den Zentren der Provinz einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert,
der sich auch im Grabbau ausdrückt. Gleichwohl offenbaren sich erkennbare Tendenzunterschiede
zwischen den Metropolen Augsburg und Regensburg. Während aus den Arealen der
Regensburger Gräberfelder zahlreiche Architekturteile von Grabbauten vorliegen
(v. Schurbein 1977, 253-259), fehlen sie im Umland von Castra Regina fast gänzlich.
Die Oberschicht der Regensburger canabae muss also weitgehend vor Ort
bestattet worden sein, d. h. sie blieb standortbezogen (Schmidts 2003, 87).
Ein weiterer Unterschied manifestiert sich in der Vorliebe für bestimmte Bildprogramme.
Augenfällig wird dies natürlich durch militärische Themen auf Regensburger Reliefs,
wie z. B. die „Pferdevorführung“ CSIR I, 1 Nr. 386, die auf rheinischen Reitergrabsteinen
in flavischer Zeit begegnet und um 200 n. Chr. schon „veraltet“ war. Auf den
Grabstelen der stadtrömischen Gardereiter (equites singulares) hielten
sich Varianten dieser Repräsentationsform der Kavalleristen dagegen länger.
Es wurde bereits angesprochen, dass man in Augsburg vorwiegend auf Reliefszenen
des Alltagsgeschäfts stößt, in Regensburg maß man mythologischen Szenen einen
höheren Stellenwert bei (Kempchen 1995). Trendwidrig zum Trierer Land, wo mythologische
Darstellungen ab der Mitte des 2. Jahrhunderts eher rückläufig sind, halten
sie sich im Regensburger Raum im frühen 3. Jahrhundert hartnäckig. Dafür wird
man in erster Linie die unterschiedliche Prägung der Orte durch ziviles Gewerbe
bzw. Militär verantwortlich machen wollen, obwohl auch in Augsburg mythologische
Szenen nicht gänzlich fehlen; erwähnt seien ein tanzender Satyr (CSIR I, 1 Nr.
66), eine bacchantische Prozession (ebd. Nr. 62) sowie der Kampf des Odysseus
mit seinen Gefährten gegen Skylla (ebd. Nr. 69). Toten- bzw. Familienmahlreliefs,
die in der Gallia Belgica und im Rheinland geradezu Standard sind, kommen in
Rätien seltener vor, doch verteilen sich die wenigen Beispiele auf Augsburg
und Regensburg gleichermaßen.  Dabei
deuten sich Weiterentwicklungen an: ein Regensburger Relief zeugt angesichts
des pietätgebietenden Todes – zumindest nach heutigem Verständnis – von unziemlichem
Humor, indem das Totenmahl geradezu in eine Wirtshausszene uminterpretiert wird,
in der ein Beteiligter einer Dame am Gewand zupft oder ihr sogar in den Hintern
zwickt (CSIR I, 1 Nr. 383)! Römische Grabmäler trachten eben danach den Lebenden
darzustellen und wurden meist auch schon zu Lebzeiten errichtet (vivus fecit
/ vivi fecerunt).
Dabei
deuten sich Weiterentwicklungen an: ein Regensburger Relief zeugt angesichts
des pietätgebietenden Todes – zumindest nach heutigem Verständnis – von unziemlichem
Humor, indem das Totenmahl geradezu in eine Wirtshausszene uminterpretiert wird,
in der ein Beteiligter einer Dame am Gewand zupft oder ihr sogar in den Hintern
zwickt (CSIR I, 1 Nr. 383)! Römische Grabmäler trachten eben danach den Lebenden
darzustellen und wurden meist auch schon zu Lebzeiten errichtet (vivus fecit
/ vivi fecerunt).
 Ein
anderes Standardthema rheinischer Grabbaureliefs bildet die aristokratischen
Lebensstil assoziierende Jagd. In Rätien wird es zum einen durch den Reliefblock
eines Pfeilergrabmals in Risstissen vertreten, zum anderen durch sechs Hundeskelette,
die neben einem Grabbaufundament in Sontheim/Brenz bestattet waren. Vermutlich
darf man sie als Beigabe einer Jagdmeute deuten (Nuber 1992, 200). In der alten
Pfarrkirche von Risstissen (Alb-Donau-Kreis) sind neben dem Jagdrelief noch
drei weitere Reliefblöcke (desselben Denkmals?) mit mythologischen Szenen eingemauert.
Sie stellen Apollon und Daphne sowie Apollon und Herkules beim Dreifußstreit
dar.
Ein
anderes Standardthema rheinischer Grabbaureliefs bildet die aristokratischen
Lebensstil assoziierende Jagd. In Rätien wird es zum einen durch den Reliefblock
eines Pfeilergrabmals in Risstissen vertreten, zum anderen durch sechs Hundeskelette,
die neben einem Grabbaufundament in Sontheim/Brenz bestattet waren. Vermutlich
darf man sie als Beigabe einer Jagdmeute deuten (Nuber 1992, 200). In der alten
Pfarrkirche von Risstissen (Alb-Donau-Kreis) sind neben dem Jagdrelief noch
drei weitere Reliefblöcke (desselben Denkmals?) mit mythologischen Szenen eingemauert.
Sie stellen Apollon und Daphne sowie Apollon und Herkules beim Dreifußstreit
dar.
 Vollplastischer
Grabbauschmuck in Gestalt von „Wächterfiguren“ (z. B. Löwen, Sphingen, Greife:
CSIR I, 1 Nr. 392 ff.) war auch in den Gräberfeldern Rätiens verbreitet. Mythologische
Figurengruppen (z. B. Ganymed- oder Aeneasgruppen) hingegen sind im Gegensatz
zu Köln, der Gallia Belgica und Obergermanien im Sepulkralkontext bisher nicht
belegbar.
Vollplastischer
Grabbauschmuck in Gestalt von „Wächterfiguren“ (z. B. Löwen, Sphingen, Greife:
CSIR I, 1 Nr. 392 ff.) war auch in den Gräberfeldern Rätiens verbreitet. Mythologische
Figurengruppen (z. B. Ganymed- oder Aeneasgruppen) hingegen sind im Gegensatz
zu Köln, der Gallia Belgica und Obergermanien im Sepulkralkontext bisher nicht
belegbar.
Altäre und Grabpfeiler, genauer ausgedrückt: Versatzstücke von solchen (z. B. Schuppendach, Kapitell, Pinienzapfen), sind ab der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts in rätischen Grabdenkmälern vielfach miteinander kombiniert worden. Das Spektrum der typisch rätischen und zumindest auch ostnorischen „Klein- und Kleinstpfeiler“ reicht bis hin zu Altären mit Schuppendach, -giebel oder Pinienzapfenbekrönung. Die Definition von „Grabbau“ (s. Grabbauten in Niedergermanien) muss hier schon auf ein Maximum des Vertretbaren ausgedehnt werden, wenn man solche Grabsteine, die bestenfalls aus zwei Baukomponenten bestehen, mit berücksichtigen möchte. Eventuell fällt die Entwicklung solcher Denkmäler – in Rätien wie in Noricum – chronologisch mit dem Einzug der Legionen zusammen.
|
|
Dieser Sachverhalt birgt die Schwierigkeit, dass lose aufgefundene Inschriftenblöcke
nicht immer zuverlässig Grabaltären oder kleineren Pfeilern zugewiesen werden
können.
Ein zweifelsfrei nach Rätien und – intensiver – nach Noricum hineinwirkender
Einfluss aus Italien sind Eckakrotere bei Altaraufsätzen. Die rätische Kombinationsfreude
weitete sich auch auf andere Denkmälergattungen aus. So ist das Bruchstück eines
Schuppendachs nicht zwangsläufig wie andernorts mit einem Grabmal zu identifizieren.
Davor warnt nämlich der bekannte Augsburger Altar für Sol Elagabal aus der Severerzeit
(CSIR I, 1 Nr. 28).

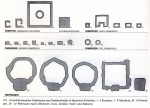 Die
zweifellos spektakulärste rätische Nekropole ist die eines römischen Landguts
(?) bei Wehringen, rund 15 km südlich von Augsburg an einer Straße gelegen,
die ca. 4,5 km nordwestlich parallel zur Via Claudia verlief. Das gilt
sowohl für die Beigabenausstattung der Gräber als auch für die fünf Grabbauten,
die einstweilen größten Rätiens (Nuber/Radnoti 1969; Nuber 2000). Der im Grundriss
stattlichste Grabbau III wird mit über 10 m Höhe veranschlagt (Fasold/Weber
1985, 199). Sie stammen aus der Zeit ab 200 n. Chr. Der gründliche Ausbruch
der Fundamente lässt ahnen, dass hier wertvolles Steinmaterial zu gewinnen war.
Die Befunderhaltung – weitgehend in Form von Ausbruchsgräben der Fundamente
– ist im Grunde genommen schlecht, doch darf die Rekonstruktion durch Architekturtrümmer,
die teils in den verfüllten Ausbruchsgruben gefunden, teils in der Wehringer
Kirche verbaut waren, als plausibel gelten. Während die Einfassungsmauern aus
Kalktuff bestanden, musste das Rohmaterial der reliefierten Kalksteine über
80 km Entfernung aus dem Bereich der Schwäbischen Alb herantransportiert werden
(Nuber 2000, 166).
Die
zweifellos spektakulärste rätische Nekropole ist die eines römischen Landguts
(?) bei Wehringen, rund 15 km südlich von Augsburg an einer Straße gelegen,
die ca. 4,5 km nordwestlich parallel zur Via Claudia verlief. Das gilt
sowohl für die Beigabenausstattung der Gräber als auch für die fünf Grabbauten,
die einstweilen größten Rätiens (Nuber/Radnoti 1969; Nuber 2000). Der im Grundriss
stattlichste Grabbau III wird mit über 10 m Höhe veranschlagt (Fasold/Weber
1985, 199). Sie stammen aus der Zeit ab 200 n. Chr. Der gründliche Ausbruch
der Fundamente lässt ahnen, dass hier wertvolles Steinmaterial zu gewinnen war.
Die Befunderhaltung – weitgehend in Form von Ausbruchsgräben der Fundamente
– ist im Grunde genommen schlecht, doch darf die Rekonstruktion durch Architekturtrümmer,
die teils in den verfüllten Ausbruchsgruben gefunden, teils in der Wehringer
Kirche verbaut waren, als plausibel gelten. Während die Einfassungsmauern aus
Kalktuff bestanden, musste das Rohmaterial der reliefierten Kalksteine über
80 km Entfernung aus dem Bereich der Schwäbischen Alb herantransportiert werden
(Nuber 2000, 166).
 Vier
Grabbauten waren tumuli mit runden bzw. polygonalen Einfassungsmauern,
die von halbwalzenförmigen Deckelsteinen bekrönt wurden. Zur Straßenfront hin
waren ihnen zweigeschossige Mausoleen oder übergroße Altäre vorgebaut. Hier
hat man Architekturelemente vereint, deren Kombination südlich wie nördlich
der Alpen exklusiv ist. Das Obergeschoss in Gestalt eines Rundtempels (Tholos)
von Grabbau III steht in Rätien bisher ohne Vergleich da, und selbst in den
Rheinprovinzen lassen sich kaum Parallelen benennen (evtl. in Xanten, s. Grabbauten
in Niedergermanien). Die norischen Baldachin-Grabmäler wiederum fallen in der
Regel kleiner aus und sind von rechteckigem Grundriss (Kremer 2001, 127-148).
Auch das zweite Mausoleum mit schlankem Tambour gilt innerhalb wie außerhalb
Rätiens vorerst als Unikat.
Vier
Grabbauten waren tumuli mit runden bzw. polygonalen Einfassungsmauern,
die von halbwalzenförmigen Deckelsteinen bekrönt wurden. Zur Straßenfront hin
waren ihnen zweigeschossige Mausoleen oder übergroße Altäre vorgebaut. Hier
hat man Architekturelemente vereint, deren Kombination südlich wie nördlich
der Alpen exklusiv ist. Das Obergeschoss in Gestalt eines Rundtempels (Tholos)
von Grabbau III steht in Rätien bisher ohne Vergleich da, und selbst in den
Rheinprovinzen lassen sich kaum Parallelen benennen (evtl. in Xanten, s. Grabbauten
in Niedergermanien). Die norischen Baldachin-Grabmäler wiederum fallen in der
Regel kleiner aus und sind von rechteckigem Grundriss (Kremer 2001, 127-148).
Auch das zweite Mausoleum mit schlankem Tambour gilt innerhalb wie außerhalb
Rätiens vorerst als Unikat.
Wie sind die rückwärtigen tumuli von bis zu 11,2 m Dm einzuordnen?
Als Rückgriff auf die rund 150 Jahre älteren „einheimischen“ Grabhügel der „Heimstetter
Gruppe“, als architektonisch unterstrichener Ausdruck eines aristokratischen
Anspruchs nach klassischem, spätrepublikanisch-frühkaiserzeitlichem Verständnis
von tumuli als Ehrengräber oder schlicht als eklektisches Architekturzitat?
Vermutlich spielen alle drei Faktoren eine Rolle. Die Aufreihung mehrerer tumuli
ist „unklassisch“ und erinnert tatsächlich an die Grabhügelgrüppchen der „Heimstettener
Gruppe“. Steinerne Rundgräber stellen in Rätien sonst vereinzelte Ausnahmeerscheinungen
dar – im Gegensatz etwa zur Gallia Belgica oder dem Mittelrheingebiet. Neben
dem oben besprochenen Kemptener Exemplar ist noch ein mit 3 m Durchmesser erheblich
kleineres Rundgrab an der östlichen Gräberstraße von Phoebiana/Faimingen erwähnenswert,
das innerhalb des Gräberfeldes allerdings keine sonderlich prominente Position
einnimmt (Fasold/Hüssen 1985, 288 u. 293).
An die Grabbauten schlossen sich noch weitere 23 Gräber ohne monumentale Grabkennzeichnung
an. Da der Friedhof unvollständig ausgegraben ist, rechnet H. U. Nuber mit ehemals
100-200 Gräbern – eine beachtliche Größe, wenn wir es tatsächlich mit einem
Villenfriedhof zu tun haben. Eine lange Belegungsdauer oder eine entsprechende
Betriebsgröße würden dies begründen. Zu den ältesten Bestattungen gehört eine
Gruppe waffenführender Männergräber aus der Zeit um 100 n. Chr. Da die übrigen
Bestattungen jedoch mit einem zeitlichen Hiatus von zwei bis drei Generationen
folgen, muss vorerst offen bleiben, ob die Waffengräber mit der Gründergeneration
des Anwesens zu identifizieren sind oder ob sie mit den späteren Grabbauherren
nichts zu tun haben (Nuber 1985a). Einstweilen bleibt festzuhalten, dass der
monumentale Grabbau erst um 200 n. Chr. einsetzt.
Eine mit keltischen Jenseitsvorstellungen vertraute Personengruppe dokumentiert
der unerhörte Beigabenluxus. Es würde den Rahmen dieses Überblicks sprengen,
alle Funde auflisten zu wollen; hierzu sei auf die Literatur verwiesen (Nuber
2000). Allein das Frauengrab 3 umfasste ungefähr 200 Gegenstände, darunter Möbel,
eine hölzerne Sänfte bzw. deren übrig gebliebene Metallteile, umfangreiche und
zum Teil kunstvoll gearbeitete Geschirre aus Metall und Holz bis hin zur Kleidung
mit Goldbrokat. Der Leichenbrand in der gläsernen Urne war in ein Seidentuch
eingeschlagen. Die Urne stand – auf der Höhe des römischen Zeitgeschmacks –
in einem Steinossuarium. In jedem der tumuli gab es nur ein Grab, lediglich
im Grabbau IV mit rechteckiger, offener Umfriedung zwei. Die Körperbestattung
eines „Leibarztes“ sowie offenkundig weiterer Bediensteter (Sklaven?) an dessen
Flanke unterstreicht die wirtschaftliche Potenz der Wehringer Familie.
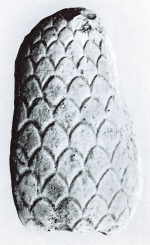 Die
relative Nähe zur Provinzhauptstadt lässt natürlich an den Landsitz einer wirtschaftlich
und gesellschaftlich tonangebenden Familie denken, z. B. an Angehörige des ordo
decurionum. Ob ein Klappstuhl aus Grab 13 als sella curulis und
damit als Amtssitz eines öffentlichen Mandatsträgers zu deuten ist oder lediglich
als Symbol eines allgemeinen elitären Anspruchs, lässt sich nicht ohne weiteres
entscheiden. Natürlich kommen auch andere (einfluss-) reiche Gesellschaftskreise
in Betracht. So war beispielsweise in Stadtbergen südlich von Augsburg der Grabaltar
eines Händlers (negotiator) vermauert (IBR 141). Sicher gab es in der
Umgebung noch weitere „Sommerresidenzen“ reicher Augsburger: nur etwa 3 km von
Wehringen entfernt kam bei Oberottmarshausen der bisher gewaltigste steinerne
Pinienzapfen Rätiens zutage (CSIR I, 1 Nr. 221). Im erhaltenen Zustand ist das
Bruchstück 129 cm hoch und 91 cm breit, ursprünglich dürfte es 150 cm hoch gewesen
sein. Als Bekrönung eines tumulus oder eines gewaltigen Pfeilergrabmals
ist er gut vorstellbar. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass dieses
Architekturschmuckstück aus Wehringen verschleppt wurde.
Die
relative Nähe zur Provinzhauptstadt lässt natürlich an den Landsitz einer wirtschaftlich
und gesellschaftlich tonangebenden Familie denken, z. B. an Angehörige des ordo
decurionum. Ob ein Klappstuhl aus Grab 13 als sella curulis und
damit als Amtssitz eines öffentlichen Mandatsträgers zu deuten ist oder lediglich
als Symbol eines allgemeinen elitären Anspruchs, lässt sich nicht ohne weiteres
entscheiden. Natürlich kommen auch andere (einfluss-) reiche Gesellschaftskreise
in Betracht. So war beispielsweise in Stadtbergen südlich von Augsburg der Grabaltar
eines Händlers (negotiator) vermauert (IBR 141). Sicher gab es in der
Umgebung noch weitere „Sommerresidenzen“ reicher Augsburger: nur etwa 3 km von
Wehringen entfernt kam bei Oberottmarshausen der bisher gewaltigste steinerne
Pinienzapfen Rätiens zutage (CSIR I, 1 Nr. 221). Im erhaltenen Zustand ist das
Bruchstück 129 cm hoch und 91 cm breit, ursprünglich dürfte es 150 cm hoch gewesen
sein. Als Bekrönung eines tumulus oder eines gewaltigen Pfeilergrabmals
ist er gut vorstellbar. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass dieses
Architekturschmuckstück aus Wehringen verschleppt wurde.

 Die
zeitlose Form der Einfriedung offener Grabgärten blieb auch im 2. und während
der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts der häufigste Grabbautyp, sei es je nach Geschmack
bzw. Geldbeutel mit Steinmauer, Hecke, Holzzaun oder bloßem Gräbchen. Hier konnte
die Familie ungestört die periodischen Gedenkfeierlichkeiten begehen. Stellvertretend
für andere Befunde seien hier Beispiele aus Kempten (um 100 n. Chr.) und Oberpeiching,
südlich der Lechmündung gelegen, abgebildet.
Die
zeitlose Form der Einfriedung offener Grabgärten blieb auch im 2. und während
der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts der häufigste Grabbautyp, sei es je nach Geschmack
bzw. Geldbeutel mit Steinmauer, Hecke, Holzzaun oder bloßem Gräbchen. Hier konnte
die Familie ungestört die periodischen Gedenkfeierlichkeiten begehen. Stellvertretend
für andere Befunde seien hier Beispiele aus Kempten (um 100 n. Chr.) und Oberpeiching,
südlich der Lechmündung gelegen, abgebildet.
Der Oberpeichinger Grabgarten hält insofern noch eine Besonderheit bereit,
als dass in seinem Inneren überraschenderweise weder ein Grab noch die Spur
irgendeines Grabbaus entdeckt werden konnte (Czysz 1999, 47). Waren die Bestattungsbehälter
hier obertätig aufgestellt, z. B. in steinernen ossuaria, ohne je Spuren
im Boden hinterlassen zu haben?
Im Erhaltungszustand bloßer Grundmauern ist eine zuverlässige Entscheidung darüber,
ob kleinere quadratische Grundrisse unterhalb von ca. 4 m Seitenlänge wirklich
offene Anlagen waren oder doch Gebäude trugen (eben Grabtempel, Kapellen oder
Grabtürme), nicht immer einfach zu fällen. Bei größeren Ausmaßen ist wegen des
höher zu veranschlagenden Dachgewichtes eine stärkere Fundamentierung unabdingbar,
nicht zwangsläufig jedoch bei den kleineren (ca. 2 x 2 m) Grundrissen. Auch
die Art der Grabanlage im Inneren liefert keine eindeutige Rekonstruktionshilfe.
Man kann also nicht automatisch auf einen offenen Grabgarten schließen, wenn
die Urne(n) in den Boden eingegraben war(en), oder auf ein überdachtes columbarium,
wenn im Inneren keine Bestattung entdeckt wurde, wie es z. B. einmal in Sontheim/Brenz
der Fall war (Schaub 1990, 159).
Dass Grabkapellen, –tempel und –türme in Rätien sehr beliebt waren, veranschaulicht
der einzige steinerne Grabbau in der o. g. Nekropole von Niedererlbach. Durch
Überdeckung mit Bachsedimenten war der Befund ungewöhnlich gut erhalten. Das
betrifft nicht nur die noch bis zu 90 cm hohe Mauersubstanz, sondern auch den
Versturz des Ziegeldachs im Inneren, der unter anderen Bedingungen längst aberodiert
oder weggepflügt worden wäre. Das 2,75 x 4 m messende Mauergeviert innerhalb
einer 9,5 x 10 m ausgreifenden Einfriedungsmauer stammt also mit Sicherheit
von einem Gebäude, das in Anlehnung an norische Beispiele als Grabturm rekonstruiert
wird (Christlein/Weber 1980). Dieser wurde im 2. Jahrhundert erbaut und bis
zur Mitte des 3. Jahrhunderts belegt.
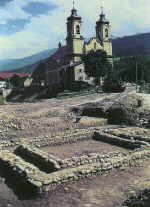 Ein
ähnlicher Doppelgrundriss aus der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts in einem Gräberfeld
von Veldidena/Innsbruck-Wilten könnte trotz schlechterer Oberflächenerhaltung
in der gleichen Weise deutbar sein (Heitmeier 2005, 67).
Ein
ähnlicher Doppelgrundriss aus der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts in einem Gräberfeld
von Veldidena/Innsbruck-Wilten könnte trotz schlechterer Oberflächenerhaltung
in der gleichen Weise deutbar sein (Heitmeier 2005, 67).
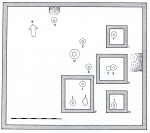 Grabkapellen
(memoriae) wird man auch die vier nahezu quadratischen Streifenfundamente
innerhalb der ummauerten, 29 x 25 m umfassenden Gutshofnekropole von Mochenwangen
in Oberschwaben zuweisen dürfen (Meyer 2003, 579-581). Auf sie verteilen sich
sieben Brandgräber, die ca. 100-160 n. Chr., also über drei Generationen hinweg
angelegt wurden.
Grabkapellen
(memoriae) wird man auch die vier nahezu quadratischen Streifenfundamente
innerhalb der ummauerten, 29 x 25 m umfassenden Gutshofnekropole von Mochenwangen
in Oberschwaben zuweisen dürfen (Meyer 2003, 579-581). Auf sie verteilen sich
sieben Brandgräber, die ca. 100-160 n. Chr., also über drei Generationen hinweg
angelegt wurden.
Die Kapellen dürften die Umfassungsmauer nur wenig überragt haben, so dass
eine repräsentative Außenwirkung kaum erzielt wurde. Die Lage an einer untergeordneten
Verbindungsstraße in Oberschwaben hätte sich hierfür auch kaum empfohlen. Die
Anlage strahlt somit eher den Charakter einer privaten domus aeterna
und rein familiären Gedenkstätte aus. Der enorme Beigabenreichtum keltischer
Prägung steht auch hier im Gegensatz zur italischen „Fassade“ der Grabbauten.
Zum Mobiliar eines Frauengrabes gehört wiederum das eiserne Gestänge eines Klappstuhls.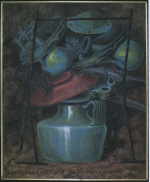 Ohne diesem einen prestigeträchtigen Repräsentationswert absprechen zu wollen,
wird man in ihm kaum eine klassische sella curulis zu erblicken haben.
Es lässt sich allenfalls darüber spekulieren, ob die Familie vielleicht eine
hervorgehobene politische oder gesellschaftliche Stellung im Verwaltungsbezirk
von Brigantium/Bregenz eingenommen hat. Wie in den gleichzeitigen Gräbern von
Wehringen oder in den älteren Männergräbern der „Heimstettener Gruppe“ fällt
erneut die „unrömische“ Waffenbeigabe auf. Wegen der Mitgabe eines Schildes
sind diese ausdrücklich als Militär-, nicht als Jagdwaffen zu deuten. Je nach
dem welche Aussagekraft man den mitgefundenen Metallbeschlägen eines Trinkhorns
beimisst, könnte man hierin ein germanisches Element erblicken. Waffengräber
waren aber auch bis zu den Südalpen verbreitet; erinnert sei an die frühkaiserzeitlichen
Grabkammern von Minusio-Cadra (s. o.). Folglich kristallisiert sich für die
Gutshofbewohner von Mochenwangen weder eine eindeutige Einwanderungsrichtung
heraus noch lässt sich eine definitiv autochthone Komponente erkennen.
Ohne diesem einen prestigeträchtigen Repräsentationswert absprechen zu wollen,
wird man in ihm kaum eine klassische sella curulis zu erblicken haben.
Es lässt sich allenfalls darüber spekulieren, ob die Familie vielleicht eine
hervorgehobene politische oder gesellschaftliche Stellung im Verwaltungsbezirk
von Brigantium/Bregenz eingenommen hat. Wie in den gleichzeitigen Gräbern von
Wehringen oder in den älteren Männergräbern der „Heimstettener Gruppe“ fällt
erneut die „unrömische“ Waffenbeigabe auf. Wegen der Mitgabe eines Schildes
sind diese ausdrücklich als Militär-, nicht als Jagdwaffen zu deuten. Je nach
dem welche Aussagekraft man den mitgefundenen Metallbeschlägen eines Trinkhorns
beimisst, könnte man hierin ein germanisches Element erblicken. Waffengräber
waren aber auch bis zu den Südalpen verbreitet; erinnert sei an die frühkaiserzeitlichen
Grabkammern von Minusio-Cadra (s. o.). Folglich kristallisiert sich für die
Gutshofbewohner von Mochenwangen weder eine eindeutige Einwanderungsrichtung
heraus noch lässt sich eine definitiv autochthone Komponente erkennen.
Während in vergleichbar dimensionierten memoriae oder columbaria in Italien obertägige Plätze zur Aufbewahrung der Urnen (Nischen o. ä.) vorhanden waren, wurden die sterblichen Überreste hier wie überhaupt in Rätien zumeist im Boden des Gebäudes beigesetzt: hierin sowie in der reichen Beigabenwahl begegnen sich italischer Bautyp und einheimische Bestattungssitte. Die marmorne, aus einer Architekturspolie zurechtgemeißelte Inschriftentafel der 40jährig verstorbenen Sicna bestätigt die keltisch-gallischen Kulturwurzeln zusätzlich durch den Namen. Sie dürfte analog zu italischen Beispielen über der Tür angebracht gewesen sein. Zu lesen steht:
Sicna Cr/ispini f(ilia) / vix(it) an(nos) XL / Proc(ulus?) mar(itus) m(erenti) f(ecit) – „Sicna, Tochter des Crispinus (liegt hier begraben). Sie lebte 40 Jahre. Proculus (?), der Ehemann, veranlasste (die Errichtung des Grabmals für seine Frau,) weil sie es verdient hat“. |
Im Luftbild eines Gutshofs mit ummauertem Grabbezirk bei Brenz (Ldkr. Heidenheim)
zeichnet sich eine mit Mochenwangen vergleichbare Anlage ab.

 Grabkapellen
oder -tempelchen vom Typ Niedererlbach und Mochenwangen gehören zu den häufigsten
Grabbauformen Rätiens. Neben den bereits vorgestellten Befunden aus Günzburg
sind darüber hinaus entsprechende Grundrisse des 2.-3. Jahrhunderts von der
Gräberstraße der Straßenstation Sontheim/Brenz (Ldkr. Heidenheim) an der Donaunordstraße
(Nuber/Schaub 1991, 174 mit Erwähnung von Dachziegelfunden), an der Donausüdstraße
südlich von Oberpeiching (Czysz 1999, 53) sowie vom Gräberfeld des Kastellvicus
Pfünz (ORL B 73, 17) bekannt. In der Nachbarprovinz Noricum waren diese Grabkapellen
noch stärker verbreitet. Dort fällt die Unterscheidung von einfachen Umfriedungen
bisweilen durch verputzte oder mit Marmorplatten vertäfelte Innenwände sowie
durch einzelne Nachweise von Holz- oder Estrichfußböden leichter (Kremer 2001,
357-359).
Grabkapellen
oder -tempelchen vom Typ Niedererlbach und Mochenwangen gehören zu den häufigsten
Grabbauformen Rätiens. Neben den bereits vorgestellten Befunden aus Günzburg
sind darüber hinaus entsprechende Grundrisse des 2.-3. Jahrhunderts von der
Gräberstraße der Straßenstation Sontheim/Brenz (Ldkr. Heidenheim) an der Donaunordstraße
(Nuber/Schaub 1991, 174 mit Erwähnung von Dachziegelfunden), an der Donausüdstraße
südlich von Oberpeiching (Czysz 1999, 53) sowie vom Gräberfeld des Kastellvicus
Pfünz (ORL B 73, 17) bekannt. In der Nachbarprovinz Noricum waren diese Grabkapellen
noch stärker verbreitet. Dort fällt die Unterscheidung von einfachen Umfriedungen
bisweilen durch verputzte oder mit Marmorplatten vertäfelte Innenwände sowie
durch einzelne Nachweise von Holz- oder Estrichfußböden leichter (Kremer 2001,
357-359).
 Für
die außerordentliche Beliebtheit solcher Grabmäler in Rätien scheinen auch die
hier im Vergleich mit den Rheinprovinzen überproportional häufig vorkommenden
quadratischen bis langrechteckigen Inschriftentafeln zu sprechen, deren Größen
je nach einstigem Anbringungsort von ca. 30 x 40 cm (Mochenwangen) bis zu ca.
122 x 54 cm (Pförring, IBR 264) schwanken.
Für
die außerordentliche Beliebtheit solcher Grabmäler in Rätien scheinen auch die
hier im Vergleich mit den Rheinprovinzen überproportional häufig vorkommenden
quadratischen bis langrechteckigen Inschriftentafeln zu sprechen, deren Größen
je nach einstigem Anbringungsort von ca. 30 x 40 cm (Mochenwangen) bis zu ca.
122 x 54 cm (Pförring, IBR 264) schwanken.
Allerdings ist das nicht sicher, denn auch andere Denkmaltypen, insbesondere
gemauerte und mit Reliefplatten verblendete Grabpfeiler kommen als Träger der
Inschriften in Frage. Die Mochenwanger Befundvergesellschaftung von Grundriss
und Inschrift ist aufschlussreich, aber bisher in der Provinz singulär. Meist
sind die Inschriftenplatten bzw. Bruchstücke von solchen später als Spolien
wiederverwendet worden, z. B. in spätantiken Festungswerken oder mittelalterlichen
Kirchen. Gliedert man die Inschriftenträger nach der Stärke des Steins, zeichnen
sich zwar grob zwei Gruppen ab, die man als Tafeln oder Platten (unter 30 cm
Dicke) bzw. als Blöcke (über 30 cm Block) bezeichnen könnte, doch hilft dieser
Versuch bei der Zuweisung an Bautypen kaum weiter.
 Einige
langrechteckige Inschriftenplatten oder –blöcke tragen Rahmen in Gestalt einer
tabula ansata, einer tendenziell militärtypischen Inschriftenfassung.
Zwei dieser Denkmäler wurden denn auch für Offiziersveteranen errichtet (Kirchheim
am Ries, IBR 304 ex centurione legionis III Italicae und Pförring,
IBR 264 ex decurione alae Aurianae), vier weitere aus Günzburg, Rettenbach
bei Günzburg, Epfach und die des Vitalius Vigor aus Augsburg sind wegen der
Kürze bzw. des Verlustes der Texte in dieser Hinsicht leider nicht mehr beurteilbar.
Die rund 60 x 90 cm messende tabula ansata-Tafel von der Günzburger
Gräberstraße verfügt außerdem über einen stiftartigen Fortsatz, mit dem sie
offenbar in einer Basis eingezapft war. Eine derartige Verwendung als waagrechte
Grabstele sucht unter den rätischen Grabdenkmälern ihresgleichen. Wäre dieser
Schaft nicht erhalten geblieben, hätte man den titulus nämlich ohne zu zögern
einem Grabbau zugesprochen. Die ursprüngliche Beschriftung ist leider verloren
ebenso wie im Falle der tabula ansata aus Epfach (IBR 89), die im 3.
Jahrhundert sekundär als Grabstele verwendet wurde. Falls sie, was zu vermuten
ist, von einem Grabbau stammt, war dieser bereits verfallen oder abgerissen
worden.
Einige
langrechteckige Inschriftenplatten oder –blöcke tragen Rahmen in Gestalt einer
tabula ansata, einer tendenziell militärtypischen Inschriftenfassung.
Zwei dieser Denkmäler wurden denn auch für Offiziersveteranen errichtet (Kirchheim
am Ries, IBR 304 ex centurione legionis III Italicae und Pförring,
IBR 264 ex decurione alae Aurianae), vier weitere aus Günzburg, Rettenbach
bei Günzburg, Epfach und die des Vitalius Vigor aus Augsburg sind wegen der
Kürze bzw. des Verlustes der Texte in dieser Hinsicht leider nicht mehr beurteilbar.
Die rund 60 x 90 cm messende tabula ansata-Tafel von der Günzburger
Gräberstraße verfügt außerdem über einen stiftartigen Fortsatz, mit dem sie
offenbar in einer Basis eingezapft war. Eine derartige Verwendung als waagrechte
Grabstele sucht unter den rätischen Grabdenkmälern ihresgleichen. Wäre dieser
Schaft nicht erhalten geblieben, hätte man den titulus nämlich ohne zu zögern
einem Grabbau zugesprochen. Die ursprüngliche Beschriftung ist leider verloren
ebenso wie im Falle der tabula ansata aus Epfach (IBR 89), die im 3.
Jahrhundert sekundär als Grabstele verwendet wurde. Falls sie, was zu vermuten
ist, von einem Grabbau stammt, war dieser bereits verfallen oder abgerissen
worden.
In zwei Fällen überliefern die Inschriften Geldsummen, die in die jeweiligen Grabbauten investiert wurden. Der Finanzjurist der rätischen Steuerkasse (advocatus fisci Raetici) Flavius Vettius Titus ließ sich sein Grabmal bei Augsburg 14000 Sesterzen kosten (IBR 176). Der bei Epfach bestattete Augsburger (?) decurio Publius Ceionius Laelianus hatte per Testament den Kostenrahmen für das Grabmal auf 6000 Sesterzen festgesetzt. Bedauerlicherweise kennen wir die durch diese Summen ermöglichten Bauleistungen nicht. Eine ungefähre Relation stellt sich ein, wenn man in Anschlag bringt, dass ein Reiteroffizier (decurio alae) um 180 n. Chr. über 7000 Sesterzen Jahreseinkommen verfügte, während ein Bergwerksarbeiter gleichzeitig nur etwa 480 Sesterzen erwirtschaften konnte.
Ambs/Faber 1998
R. Ambs/A. Faber, Ein Bestattungsplatz der provinzialen Oberschicht Raetiens
an der Donausüdstraße bei Nersingen-Unterfahlheim. Ber. RGK 79, 1998, 383-478.
Bakker 1984
L. Bakker, Neue Inschriftenfunde aus Augusta Vindelicum-Augsburg. Arch. Jahr
Bayern 1984, 110-112.
Bakker 1985
L. Bakker, Das Pfeilergrabmal von Augsburg-Oberhausen. In: Die Römer in Schwaben.
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 27 (München 1985) 203-205.
Bakker 1985a
L. Bakker, Weinverkauf und Kontorszene auf dem Grabmal des Pompeianius Silvinus
aus Augsburg. In: Die Römer in Schwaben. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,
Arbeitsheft 27 (München 1985) 129 f.
Bakker 1985b
L. Bakker, Das municipium Aelium Augustum und seine Verwaltung. In: Die Römer
in Schwaben. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 27 (München
1985) 96-98.
Bakker 1998
L. Bakker, Steindenkmäler an einer Gräberstraße in der raetischen Provinzhauptstadt
AELIA AVGVSTA. Arch. Jahr Bayern 1998, 85-87.
Bakker 2005
L. Bakker, Zu den beiden Inschriften des Claudius Paternus Clementianus aus
ABODIACVM/Epfach. Carinthia 195, 2005, 567-569.
Christlein 1980
R. Christlein, Ein spätkeltischer Friedhof von Hörgertshausen, Landkreis Freising,
Oberbayern. Arch. Jahr Bayern 1980, 108 f.
Christlein/Weber 1980
R. Christlein/G. Weber, Ein römisches Mausoleum bei Niedererlbach, Gemeinde
Buch am Erlbach, Landkreis Landshut, Niederbayern. Arch. Jahr Bayern 1980, 140
f.
Codreanu-Windauer u. a. 2000
S. Codreanu-Windauer/W. Irlinger/J. Fassbinder/R. Haase, Römische Spuren in
Blüte: Die Villae rusticae von Burgweinting. Arch. Jahr Bayern 2000, 70-73.
CSIR I, 1
Wagner 1973
F. Wagner, Raetia (Bayern südlich des Limes) und Noricum (Chiemseegebiet). Corpus
Signorum Imperii Romani (CSIR) Deutschland I, 1 (Bonn 1973).
Czysz 1995
W. Czysz, Totenbrauchtum, Gräber und Friedhöfe. In: Ders./K. Dietz/Th. Fischer/H.-J.
Kellner u. a., Die Römer in Bayern (Stuttgart 1995) 288-308.
Czysz 1999
W. Czysz, Der Tod im Topf. Ausgrabungen im römischen Gräberfeld von Oberpeiching
bei Rain am Lech (Friedberg 1999).
Czysz 2002
W. Czysz, GONTIA – Günzburg in der Römerzeit. Archäologische Entdeckungen an
der bayerisch-schwäbischen Donau (Friedberg 2002) 123-168.
Dietz/Weber 1982
K. Dietz/G. Weber, Fremde in Rätien. Chiron 12, 1982, 409-443.
Dietz 1985
K. Dietz, Claudius Paternus Clementianus, ein vornehmer Ritter aus Rätien. In:
Die Römer in Schwaben. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft
27 (München 1985) 101-104.
Dietz 2004
K. Dietz, Zur vorrömischen Bevölkerung nach den Schriftquellen. In: C.-M. Hüssen/W.
Irlinger/W. Zanier (Hrsg.), Spätlatènezeit und frühe römische Kaiserzeit zwischen
Alpenrand und Donau. Akten des Kolloquiums in Ingolstadt am 11. und 12. Oktober
2001 (Bonn 2004) 1-23.
Faber 1991
A. Faber, Früh- und mittelkaiserzeitliche Gräber von der Keckwiese in Cambodunum-Kempten.
Arch. Jahr Bayern 1991, 117-119.
Faber 1998
A. Faber, Das römische Gräberfeld auf der Keckwiese in Kempten. II. Gräber der
mittleren Kaiserzeit und Infrastruktur des Gräberfelds sowie Siedlungsbefunde
im Ostteil der Keckwiese. Cambodunumforschungen VI (Kallmünz/Opf. 1998).
Faber 2000
A. Faber, Die Stadt, der Tod und der Müll – Die Nekropolen. In: G. Weber (Hrsg.),
Cambodunum-Kempten. Erste Hauptstadt der römischen Provinz Raetien? (Mainz 2000)
127-133.
Faber 2001
A. Faber, Grabmäler und Bestattungen des 1. Jahrhunderts im Gebiet der Provinz
Raetia et Vindelica. In: Deutsches Archäologisches Institut (Hrsg.), Römischer
Bestattungsbrauch und Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwestprovinzen
von der späten Republik bis in die Kaiserzeit. Palilia 8 (Wiesbaden 2001) 305-319.
Faber/Koch 2004
A. Faber/H. Koch, Die Lehrgrabung 2004 der Gesellschaft für Archäologie in Bayern
im römischen Gräberfeld von Niedererlbach. Arch. Jahr Bayern 2004, 94-96.
Fasold/Hüssen 1985
P. Fasold/C.-M. Hüssen, Römische Grabfunde aus dem östlichen Gräberfeld von
Faimingen – Phoebiana, Ldkr. Dillingen a. d. Donau. Bayerische Vorgeschichtsblätter
50, 1985, 287-340.
Fasold/Weber 1985
P. Fasold/G. Weber, Grabbauten in Rätien. In: Die Römer in Schwaben. Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 27 (München 1985) 198-201.
Fasold/Witteyer 2001
P. Fasold/M. Witteyer, Tradition und Wandel im Grabbrauch Rätiens und Obergermaniens
während der frühen Kaiserzeit. In: In: Deutsches Archäologisches Institut (Hrsg.),
Römischer Bestattungsbrauch und Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwestprovinzen
von der späten Republik bis in die Kaiserzeit. Palilia 8 (Wiesbaden 2001) 293-304.
Freigang 1997
Y. Freigang, Die Grabmäler der gallo-römischen Kultur im Moselland. Studien
zur Selbstdarstellung einer Gesellschaft. Jahrb. RGZM 44/1, 1997, 277-440.
Gauer 1978
W. Gauer, Die raetischen Pfeilergrabmäler und ihre moselländischen Vorbilder.
Bayerische Vorgeschichtsblätter 43, 1978, 57-97.
Gebhard 2004
R. Gebhard, Die spätkeltische Gräbergruppe von Hörgertshausen, Lkr. Freising.
In: C.-M. Hüssen/W. Irlinger/W. Zanier (Hrsg.), Spätlatènezeit und frühe römische
Kaiserzeit zwischen Alpenrand und Donau. Akten des Kolloquiums in Ingolstadt
am 11. und 12. Oktober 2001 (Bonn 2004) 105-112.
Hagendorn/Nuber/Scheuerbrandt 1993
A. Hagendorn/H. U. Nuber/J. Scheuerbrandt, Ein zweites Gräberfeld und weitere
Grabbauten in Sontheim/Brenz „Braike“, Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg
1993, 198-201.
Heitmeier 2005
I. Heitmeier, Das Inntal. Siedlungs- und Raumentwicklung eines Alpenlandes im
Schnittpunkt der politischen Interessen von der römischen Okkupation bis in
die Zeit Karls des Großen (Innsbruck 2005).
IBR
F. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae sive inscriptiones prov. Raetiae
adiectis aliquot Noricis Italicisque (München 1915).
Keller 1984
E. Keller, Die frühkaiserzeitlichen Körpergräber von Heimstetten bei München
und die Verwandten Funde aus Südbayern. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 37
(München 1984).
Kempchen 1995
M. Kempchen, Mythologische Themen in der Grabskulptur. Germania Inferior, Germania
Superior, Gallia Belgica und Raetia. Charybdis 10 (Münster 1995).
Kockel 1993
V. Kockel, Porträtreliefs stadtrömischer Grabbauten. Ein Beitrag zur Geschichte
und zum Verständnis des spätrepublikanisch-frühkaiserzeitlichen Privatporträts
(Mainz 1993).
Kossak 2000
G. Kossak, Wagen und faltbarer Sessel in Gräbern römischer Provinzen. Bayer.
Vorgeschichtsbl. 65, 2000, 97-107.
Kraft 1964
K. Kraft, Die Inschriftsteine aus Epfach. In: J. Werner (Hrsg.), Studien zu
Abodiacum – Epfach (München 1964) 70-83.
Kremer 2001
G. Kremer, Antike Grabbauten in Noricum (Wien 2001).
Leja/Thoma 1990
F. Leja/H. Thoma, Archäologische Sondagen in Windwürfen – Ein römischer Friedhof
und Spuren des Lagerdorfes beim Kastell Dambach. Arch. Jahr Bayern 1990, 113-115.
Mackensen 1978
M. Mackensen, Das römische Gräberfeld auf der Keckwiese in Kempten. I. Gräber
und Grabanlagen des 1. und 4. Jahrhunderts. Cambodunumforschungen IV (Kallmünz/Opf.
1978).
Mackensen 1987
M. Mackensen, Frühkaiserzeitliche Kleinkastelle bei Nersingen und Burlafingen
an der oberen Donau (München 1987).
Martin-Kilcher 1998
St. Martin-Kilcher, Gräber der späten Republik und der frühen Kaiserzeit am
Lago Maggiore: Tradition und Romanisierung. In: P. Fasold u. a. (Hrsg.), Bestattungssitte
und kulturelle Identitaet. Grabanlagen und Grabbeigaben der fruehen roemischen
Kaiserzeit in Italien und den Nordwest-Provinzen (Koeln/Bonn 1998) 191-252.
Metzger 2004
I. R. Metzger, Roveredo GR-Tre Pilastri. Ausgrabungen des Rätischen Museums
von 1965. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft Ur- u. Frühgeschichte 87,
2004, 71-116.
Nuber/Radnoti 1969
H. U. Nuber/A. Radnoti, Römische Brand- und Körpergräber aus Wehringen, Ldkr.
Schwabmünchen. Jahresbericht der bayerischen Bodendenkmalpflege 10, 1969, 27-49.
Nuber 1985
H. U. Nuber, Ein Bergwerkspächter in Rätien. In: Die Römer in Schwaben. Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 27 (München 1985) 130 f.
Nuber 1985a
H. U. Nuber, Waffengräber aus Wehringen. In: Die Römer in Schwaben. Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege, Arbeitsheft 27 (München 1985) 52 f.
Nuber/Schaub 1991
H. U. Nuber/A. Schaub, Fortsetzung der Ausgrabungen im römischen Gräberfeld
Sontheim/Brenz, „Braike“, Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1991,
174-177.
Nuber 1992
H. U. Nuber, Mensch und Tier im römischen Brandgräberfeld von Sontheim/Brenz-„Braike“,
Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1992, 198-200.
Nuber 2000
H. U. Nuber, Eine Grablege reicher Landbesitzer in Wehringen. In: L. Wamser
in Zusammenarbeit mit Ch. Flügel und B. Ziegaus (Hrsg.), Die Römer zwischen
Alpen und Nordmeer. Zivilisatorisches Erbe einer europäischen Militärmacht.
Ausstellungskatalog Rosenheim 2000, 166-170.
Radnoti 1972
A. Radnoti, Eine Grabinschrift aus Leutstetten (Lkr. Starnberg, Obb.). Chiron
2, 1972, 437-447.
Rieder 1984
K. H. Rieder, Eine römische Sumpfbrücke bei der Feldmühle im Wellheimer Trockental.
Arch. Jahr Bayern 1984, 106 f.
Schaub 1990
A. Schaub, Ausgrabungen im römischen Gräberfeld Sontheim/Brenz, Kreis Heidenheim.
Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1990, 159-162.
Schmidts 2003
Thomas Schmidts, Verbauter Mythos – Relief eines Grabmals aus Regensburg. Bayer.
Vorgeschbl. 68, 2003, 79-88.
von Schnurbein 1977
S. von Schnurbein, Das römische Gräberfeld von Regensburg (Kallmünz/Opf. 1977).
Schromm 2003
A. Schromm, Das Kapitell von Staufen – eine neue Deutung. Jahrb. des Historischen
Vereins Dillingen an der Donau 104, 2003, 13-27.
Simonett 1941
C. Simonett, Tessiner Gräberfelder. Monogr. Ur- u. Frühgesch. Schweiz (Basel
1941) 163-169.
Struck 1996
M. Struck, Römische Grabfunde und Siedlungen im Isartal bei Ergolding, Landkreis
Landshut (Kallmünz/Opf. 1996).
Wolff 1984
H. Wolff, Grabmäler- und Inschriftenfunde in Passau im Jahre 1980/81. Bayer.
Vorgeschichtsbl. 49, 1984, 87-98.
Zanier 2004
W. Zanier, Gedanken zur Besiedlung der Spätlatène- und frühen römischen Kaiserzeit
zwischen Alpenrand und Donau. In: C.-M. Hüssen/W. Irlinger/W. Zanier (Hrsg.),
Spätlatènezeit und frühe römische Kaiserzeit zwischen Alpenrand und Donau. Akten
des Kolloquiums in Ingolstadt am 11. und 12. Oktober 2001 (Bonn 2004) 237-264.