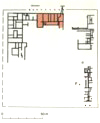Colonia Ulpia Traiana -Xanten
Gründung und Aufbau
Die colonia Ulpia Traiana(CUT) war um
100/105 n. Chr., wie der Beiname besagt, in der Regierungszeit Kaiser Traians
gegründet worden. Sie befand sich auf dem Areal einer bestehenden älteren
Siedlung, innerhalb derer sich mehrere aufeinander folgende Auxiliarlager
nachweisen ließen. Mit der Gründung der Kolonie wurde die Bebauung neu gestaltet.
Ihr Ausbau mit öffentlichen Großbauten setzte sich in der ersten Hälfte des
2. Jh. n. Chr. fort, wobei die Aktivitäten in hadrianischer Zeit ausgeprägt waren,
was dem Besuch des Kaisers in der Provinz 121/122 n. Chr. zusammenhängen dürfte.
Bis in die zweite Hälfte des 2. Jh. n. Chr. ist weitere öffentliche Bautätigkeit nachweisbar.
In diesen Zeitraum fällt auch die Bebauung zuvor nicht genutzter Flächen mit
Wohnbauten.
Militärlager und Vorgängersiedlung
Einzelne, militärisch zu wertende Baubefunde und die Verteilung von Militärausrüstung lassen auf dem Areal der späteren Kolonie vier Kastellareale, die nacheinander vom zweiten Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr. an belegt waren, erkennen. Dazu kommen noch eine zugehörige Zivilsiedlung sowie ein Gräberfeld. Eine großflächige Zerstörung fand im Zuge des Bataveraufstands des Jahres 69 n. Chr. statt. Im Bereich der Capitolsinsula (insula 26) konnten insgesamt sechs Holzbauphasen beobachtet werden, wobei die drei älteren militärischen, die jüngeren hingegen zivilen Charakter hatten. In diesem Bereich konnte auch eine Räucherei aus den 70er- 80er Jahre des 1. Jh. n. Chr. nachgewiesen werden. Bebauungsmuster einheimisch-germanischer Prägung fehlen, allerdings weisen Grabinventare und Keramikfunde auf einen solchen Bevölkerungsanteil.
In 3 km Entfernung befand sich das ebenfalls 69 n. Chr. zerstörte Doppellegionslager Vetera I. Ihm folgte 1 km weiter östlich ab ca. 71 n. Chr. das Legionslager Vetra II, das bis ins späte 3. Jh. n. Chr. bestand.
Stadtanlage
Mit der Gründung der Veteranenkolonie wurde ein rechteckiges Straßenraster mit 40 Gebäudeblocks (insulae) angelegt. Deren Orientierung war unabhängig von älteren Wegeführungen. Die quadratischen insulae waren am Schnittpunkt der Hauptstraßen 148 m (=500 römische Fuß) groß und ansonsten etwas kleiner (ca. 120 m). Die 73 ha große Siedlung wurde von einer 3,4 km langen Stadtmauer umschlossen. Deren Erbauung lässt sich mittels der Eichenpfähle, auf denen das Fundament ruhte, in die Jahre 105/106 n. Chr. datieren. Zur Stadtmauer gehörten fünf Tore sowie Eck- und Zwischentürme. Die im Fundamentbereich bis zu 3,5 m breite Mauer war mit Tuffsteinen verkleidet und innen mit einem Erdwall verstärkt. Ein Umbau der Tore erfolgte in der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr.
Öffentliche Gebäude und
Funktionsbauten
Das Forum (insula 25) wurde an der Ostseite von einer Basilika (120 x 23 m) abgeschlossen. An den Schmalseiten befanden sich abgetrennte Räumlichkeiten. Der Hof des Forums war an zwei Seiten von einer Doppelreihe Tabernen eingefasst, die sich zum Innenhof bzw. zur Straße hin öffneten. Die Erbauung begann um 130 n. Chr. und dauerte bis in die zweite Jahrhunderthälfte. So erwähnt eine ins Jahr 160 n. Chr. datierende Inschrift aus Bonn die Lieferung von Steinmaterial für den Forumsbau durch eine Flottenabteilung.
Das auf der angrenzenden insula 26 befindliche Kapitol war auf vier Seiten von Portiken umschlossen. In der Mitte des Innenhofs lag der Tempel (ca. 50 x 30 m). Der für die verehrten Gottheiten Iupiter, Iuno und Minerva dreigeteilte Bau besaß einen Kultraum (cella) und eine Vorhalle.
Der Hafentempel an der Ostseite der Stadt (insula 37) musste aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse stark fundamentiert werden. Der Tempel mit Säulenumgang (36 x 24 m) stand auf einem 3 m hohen Podium. Es handelt sich um einen Ringhallentempel (Peripteros), dessen Höhe auf ca. 27 m rekonstruiert wird. Er war von einer Umfassungsmauer umgeben. Seine Erbauung datiert kurz nach 105/106 n. Chr. Die verehrte Gottheit ist unbekannt.
Ein gallorömischer Umgangstempel mit Umfassungsmauer befand sich innerhalb der ansonsten mit Wohnbauten belegten insula 20. In der Nähe gefundene Inschriften waren den Aufanischen Matronen geweiht. Deren Verehrung lässt sich ab 160 n. Chr. nachweisen.
Die großen Thermen (ca. 120 x 120 m) nahmen die Fläche eines gesamten Gebäudeblocks (insula 10) ein. Die Anlage wurde durch eine Basilika (67 x 19 m) betreten. Mit seinen aufeinander folgenden Baderäumen vertritt sie den Reihentyp. Zu den Thermen gehörte auch eine Latrinenanlage sowie ein großer Hof für gymnastische Übungen (Palästra). Hölzer datieren den Baubeginn in die Jahre um 125 n. Chr.
Südlich der Thermen (insula 11) befand sich ein als Verwaltungspalast bezeichneter Gebäudekomplex, der sich weiter auf den östlich angrenzenden Gebäudeblock (insula 18) ausdehnte. Die repräsentative Architektur des Baus wird als Hinweis auf eine Nutzung als Amtssitz eines hohen Verwaltungsbeamten gedeutet. An der Außenseite befanden sich kleinere Gebäude, die an Markthallen oder Magazine erinnern.
Ein 80 m langes Gebäude mit einer Abfolge von Räumen an einem Gang sowie einer kleinen, an der Südseite anschließenden Badeanlage wird als Herberge interpretiert (insula 38). Die Größe der Räume, die sich über einen Mitteltrakt erschlossen, betrug 20-60 m2.
Das Amphitheater (99 x 87 m) lag in der Südostecke der Stadt. Zuerst als Holzbau und in der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. als Steinbau ausgeführt, bot es ca. 10.000 Besuchern Platz. In der Mitte der Arena sind Kellerräume nachgewiesen, von denen aus eine Hebebühne bedient werden konnte.
Wohnbebauung
Bislang konnte auf 13 der insgesamt 40 insulae Wohnbebauung
nachgewiesen werden. Diese bestand überwiegend aus Stein- oder Ziegelsockeln,
auf denen Lehmfachwerkwände standen.
Die Bebauungsstrukturen auf den insulae 19 und 27 liegen
lassen sich gut vergleichen. In beiden Fällen lagen die langrechteckigen
Häuser hinter einer straßenseitigen Portikus, die über eine gemeinsame Außenwand
verfügten. Die Grundflächen der einzelnen Baukörper betrugen 600-700 m2.
Die Frontbreiten lagen zwischen 12,3 und 15 m, die Längen zwischen 50 und
60 m. Zumindest Teile der Bauten dürften zweigeschossig gewesen sein; es
ist zudem mit Innenhöfen zu rechnen. Der vordere Teil der Häuser bestand
jeweils
aus einem großen, gewerblich genutzten Raum, die kleinteiligeren Wohnräume
lagen dahinter. Innerhalb der insula 19 wurden Wäschereien oder Färbereien,
auf der insula 27 Metzgereien und Bronzegießerwerkstätten nachgewiesen.
Die im Südosten der Stadt gelegene insula 39 weist ebenfalls langrechteckige Häuser mit gemeinsamen Innenwände auf. Das Bebauungsschema ist jedoch unregelmäßig, die Frontbreiten lagen zwischen 6,8 und 12,5 m. Die koloniezeitliche Bebauung setzte hier erst gegen Mitte des 2. Jh. n. Chr. ein.
Im Westteil der Stadt (insula 3) befanden sich aufwändigere Wohnbauten mit villenartigem Grundriss und Gärten mit Wasserbecken im rückwärtigen Teil. Die Wohnfläche eines solchen nahezu vollständig untersuchten Baus betrug mehr als 400 m2 ohne Berücksichtigung des Gartens.
Außerhalb der Stadtmauern befanden sich Handwerksbetriebe, insbesondere Töpfereien. Dies dürfte mit der Feuergefährlichkeit dieser Werkstätten in Zusammenhang stehen.
Hafen
Die Stadt lag in der Antike an einem Altrheinarm, der eine schiffbare Rinne besaß. Eine hölzerne Mole ist bereits im 1. Jh. n. Chr. nachgewiesen, im zweiten Viertel des 2. Jh. n. Chr. wurde die Oberfläche der Anlegestelle mit einer Steinschicht befestigt und eine Landungsbrücke angelegt. Aufgrund der zunehmenden Verlandung wurde der Hafen nach 175 aufgegeben.
Wasserversorgung
Eine aus mehreren Quellen südlich der Kolonie gespeiste, 6 km lange, gemauerte Wasserleitung versorgte insbesondere die Thermen mit Wasser. Innerhalb der Stadt sind in den Wohnvierteln auch Brunnen und Zisternen nachgewiesen. Die Entwässerung wurde durch Kanäle in den Straßen gewährleistet.
Sichtbare Reste
Das Areal der CUT liegt großteils innerhalb des Archäologischen Parks Xanten. Dort wurden die Stadtmauer sowie zahlreich Bauten entweder komplett oder teilweise rekonstruiert.
Museum
Römische Funde werden im Regionalmuseum Xanten ausgestellt.
Thomas Schmidts
Literatur (Auswahl)
H. Berkel, Reste römischer Wasserleitungen im Raum Xanten. In: Grabung – Forschung – Präsentation. Festschrift Gundolf Precht. Xantener Berichte 12 (Mainz 2002) 129-147.
C. Bridger, Colonia Ulpia Traiana, Insula 38: Die Befunde der Grabung 1979 bis 1983. Rheinische Ausgrabungen 31 (Köln, Bonn 1989).
W. Böcking, Der Niederrhein zur römischen Zeit. Archäologische Ausgrabungen in Xanten (Kleve 1987).
Y. Freigang, Das Heiligtum der Insula 20 in der Colonia Ulpia Traiana. In: Xantener Berichte 6 (Köln 1995) 139-234.
Ch. Geyer, Das "Kleine Hafentor" der Colonia Ulpia Traiana. Ein Rekonstruktionsversuch. In: Xantener Berichte 8 (Köln 1999) 61-171.
E. Goddard, Colonia Ulpia Traiana. Die Ausgrabungen im Bereich des Hauses am kleinen Hafentor (Insula 38) (Bergisch-Gladbach 1996).
U. Heimberg/A. Rieche, Colonia Ulpia Traiana. Die römische Stadt. Planung, Architektur, Ausgrabung. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 18 (Köln 1998).
H. Hinz, Xanten zur Römerzeit. Kulturstätten am Niederrhein 1 (Xanten5 1973).
H. Hinz, Colonia Ulpia Traiana. Die Entwicklung eines römischen Zentralortes am Niederrhein. I. Prinzipat. ANRW II/4, 1975, 825-869.
H. G. Horn (Hrsg.), Die Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987) 626-650.
K. H. Lenz, Der antike Name des frühkaiserzeitlichen Siedlungsgefüges römischer Hilfstruppenlager und Lagervici im Areal der Colonia Ulpia Traiana (Xanten). Zu den Civitas-Hauptorten des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Niedergermanien. Archäologisches Korrespondenzblatt 33/3, 2003, 375-392.
K. H. Lenz, Militaria des 1. Jahrhunderts n. Chr. aus dem Areal der Colonia Ulpia Traiana. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. In: Xantener Berichte 9 (Mainz 2001) 79-85.
G. Precht, Die Ursprünge der Colonia Ulpia Traiana. In: Traian in Germanien (Bad Homburg v. d. Höhe 1999) 213-225.
G. Precht, Neue Befunde zur vorcoloniazeitlichen Siedlung. Die Grabungen an der Südostecke der Capitols- und Forumsinsula. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 6 (Mainz 2001) 37-56.
G. Precht, Konstruktion und Aufbau sogenannter römischer Streifenhäuser am Beispiel von Köln (CCAA) und Xanten (CUT). In: Haus und Siedlung in den römischen Nordwestprovinzen. Grabungsbefund, Architektur und Ausstattung (Homburg/Saar 2002) 181-198.
A. Rieche, Führer durch den Archäologischen Park Xanten. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 15 (Köln 1994).
H.-J. Schalles, Städte im Rheinland: das Beispiel Xanten. In: Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Ausstellungskatalog Rosenheim (Mainz 2000) 104-107.
H.-J. Schalles, Überlegungen zur Planung der Colonia Ulpia Traiana und ihrer öffentlichen Bauten im Spiegel städtischer Architektur des 2. Jahrhunderts n. Chr. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 6 (Köln 1995) 379-428.
Tatort CUT. Die Spur führt nach Xanten. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 17 (Köln 1995).
N. Zieling, Die großen Thermen der Colonia Ulpia Traiana. Die öffentliche Badeanlage der römischen Stadt bei Xanten. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 19 (Köln 1999).
Reihen mit Berichten zur Geschichte und Archäologie der CVT:
Colonia Ulpia Traiana. 1-6. Arbeitsbericht zu den Grabungen und Rekonstruktionen. 7. Grabung, Forschung, Präsentation. (Köln 1975-1992).
Xantener Berichte 1-13. Hrsg.: Landschaftsverband Rheinland ; Archäologischer Park/Regionalmuseum Xanten (Köln bzw. Mainz 1992-2003).