Der geographische Begriff Grosse Schüttinsel bezeichnet eine Region der Südslowakei, die vom Süden durch Hauptdonaustrom und vom Norden durch Kleindonau begrenzt wird. Es handelt sich eigentlich um ein binnenländisches Donaudelta, das durch Verzweigung des Flussbettes nach dem Durchfluss durch Kleinkarpaten entstanden ist und das von Bratislava bis heutige Komárno reicht. Vor der Regulierung des Donauflusses war das ganze Gelände mit einem Netz von Nebenarmen und Meandern durchgewebt, die manchmal, in Abhängigkeit von den hydrologischen Bedingungen, ihren Lauf änderten. Die Lebensverhältnisse im sumpfigen Gebiet erschwerten noch die sich wiederholende Überschwemmungen. In Gegenwart, nach der weiträumigen Entwässerung gehört die Grosse Schüttinsel zu den fruchtbarsten in der Slowakei, aber noch im 18. Jahrhundert musste das Getreide hierher eingeführt sein. In den 30. Jahren des 20. Jahrhundert wurde auf den Seiten der hydrologischen Fachliteratur eine interessante Diskussion über die Lokalisierung des Hauptdonaustroms in Vergangenheit eröffnet. Aufgrund der Interpretation einiger Passagen bei Ptolemaios und der älteren mittelalterlichen Karten wurde die Meinung geäußert, dass die Donau in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten nördlich, ungefähr im Raum der heutigen Kleindonau, floss. Erst im Mittelalter sollte der Fluss durch die Verlegung ihres Laufes in das heutige Flussbett gelangen. Diese Hypothese blieb nicht ohne Einfluss auf die historisch-archäologische Forschung. Denn die Grenze des Römerreiches entlang des Hauptdonaustroms laufen musste, vertrat vor allem F. Křížek die Ansicht, dass auch die Grosse Schüttinsel und damit auch ein Stück der Südslowakei in der Kaiserzeit zum Imperium gehörte – konkret zur Provinz Pannonia. Es störte ihn nicht, dass die Linie der pannonischen Grenzkastelle sich 20-30 Kilometer südlich – entlang des rechten Donauufers, bzw. des rechten Ufers des Mosoner Donauarmes – befand. Mit den archäologischen Beweisen argumentierte man jedoch nur wenig, denn die Schüttinsel damals zu den am schwächsten erforschten Regionen der Slowakei gehörte. Erst die Veröffentlichung der Funde aus dem quadischen Gräberfeld von Dunajská Streda und vor allem die Entdeckung einer ausgedehnten germanischen Siedlung bei Veľký Meder beendete die Diskussion ob die Schüttinsel römisch oder germanisch war, zum Vorteil der zweiten von beiden erwähnten Alternativen.

 Die Siedlung von Veľký Meder erstreckt sich auf einer Gruppe der
drei dünenartigen Anhöhen, umflossen von einem heute ausgetrockneten Flussmeander.
Aufgrund der systematischen Prospektion kann angenommen werden, dass das besiedelte
Areal in der römischen Kaiserzeit eine Fläche von 6-8 Hektar erreicht hat. Von der Donau mit der römischen Reichsgrenze ist die Ansiedlung 7 km in der Luftlinie entfernt und am
nächsten liegen die Limeskastelle Ad Statuas (heute Ács-Vaspuszta) und Arrabona (heute Györ) in der Entfernung von 15, bzw. 16 km. Die Anfänge der Siedlung können in den Jahren vor oder während der Markomannenkriege gesucht werden. Zum deutlichen Besiedlungsaufschwung
kam es erst im nachfolgenden severischen Zeitabschnitt.
Beachtenswert ist die Tatsache, dass die Fundstelle von Veľký Meder knapp am
Rande des 7 Kilometer breiten Streifens entlang des nördlichen Donauufers liegt,
der aufgrund der Abmachungen während der Markomannenkriege siedlungsfrei bleiben sollte.
Die Siedlung von Veľký Meder erstreckt sich auf einer Gruppe der
drei dünenartigen Anhöhen, umflossen von einem heute ausgetrockneten Flussmeander.
Aufgrund der systematischen Prospektion kann angenommen werden, dass das besiedelte
Areal in der römischen Kaiserzeit eine Fläche von 6-8 Hektar erreicht hat. Von der Donau mit der römischen Reichsgrenze ist die Ansiedlung 7 km in der Luftlinie entfernt und am
nächsten liegen die Limeskastelle Ad Statuas (heute Ács-Vaspuszta) und Arrabona (heute Györ) in der Entfernung von 15, bzw. 16 km. Die Anfänge der Siedlung können in den Jahren vor oder während der Markomannenkriege gesucht werden. Zum deutlichen Besiedlungsaufschwung
kam es erst im nachfolgenden severischen Zeitabschnitt.
Beachtenswert ist die Tatsache, dass die Fundstelle von Veľký Meder knapp am
Rande des 7 Kilometer breiten Streifens entlang des nördlichen Donauufers liegt,
der aufgrund der Abmachungen während der Markomannenkriege siedlungsfrei bleiben sollte.
 Die Nähe der Donaugrenze und vor allem der Märkte
in den Lagervici der nächsten Kastelle spiegelte sich im regelmäßigen und hohen Zufuhr der provinzial-römischen Erzeugnisse zu den germanischen Einwohnern von Veľký Meder. Der römische Import ist fast in allen
Sphären der damaligen Sachkultur belegt, beginnend mit Schmuckgegenständen, über Münzen, Glas, Terra sigillata bis zu den geläufigen Keramikgefäßen aus den Töpfereien auf dem Provinzgebiet. Eine wiederholende Anwesenheit der Eselknochen
in den kaiserzeitlichen Fundkomplexen belegt, dass auch diese mediterrane Tierart,
wahrscheinlich dank der Handelskontakte seinen Weg auf den nördlichen – "barbarischen" – Donauufer fand. Um die Frage zu beantworten, was für eine Rolle der Import im quadischen Milieu gespielt hat, dient der Archäologie am besten importierte römische Keramik. Ihre quantitative Menge kann man ziemlich einfach mit der Anzahl
der heimischen germanischen Gefäße vergleichen. Eben in diesem Licht nimmt unsere Siedlung eine herausragende
Stellung ein, denn die Zufuhr der importierten Keramik zu den Einwohnern von
Veľký Meder besonders intensiv war. Nicht standzuhalten ist der Einwand, dass
für den hohen Importanteil in Veľký Meder nur die Limesnähe verantwortlich ist.
Die Nähe der Donaugrenze und vor allem der Märkte
in den Lagervici der nächsten Kastelle spiegelte sich im regelmäßigen und hohen Zufuhr der provinzial-römischen Erzeugnisse zu den germanischen Einwohnern von Veľký Meder. Der römische Import ist fast in allen
Sphären der damaligen Sachkultur belegt, beginnend mit Schmuckgegenständen, über Münzen, Glas, Terra sigillata bis zu den geläufigen Keramikgefäßen aus den Töpfereien auf dem Provinzgebiet. Eine wiederholende Anwesenheit der Eselknochen
in den kaiserzeitlichen Fundkomplexen belegt, dass auch diese mediterrane Tierart,
wahrscheinlich dank der Handelskontakte seinen Weg auf den nördlichen – "barbarischen" – Donauufer fand. Um die Frage zu beantworten, was für eine Rolle der Import im quadischen Milieu gespielt hat, dient der Archäologie am besten importierte römische Keramik. Ihre quantitative Menge kann man ziemlich einfach mit der Anzahl
der heimischen germanischen Gefäße vergleichen. Eben in diesem Licht nimmt unsere Siedlung eine herausragende
Stellung ein, denn die Zufuhr der importierten Keramik zu den Einwohnern von
Veľký Meder besonders intensiv war. Nicht standzuhalten ist der Einwand, dass
für den hohen Importanteil in Veľký Meder nur die Limesnähe verantwortlich ist. 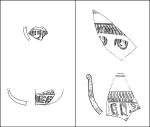 Auch die
Siedlungsagglomeration von Bratislava-Trnávka ist nur 7-8 Kilometer von der
Donaugrenze entfernt und die Importanteile erreichten nur die Halbwerte. Zum
Beispiel im 2. Jh. nahm der Importanteil in Bratislava-Trnávka 12 % vom gesamten Töpferware aus der Ansiedlung
und in Veľký Meder war das fast 20 %. Im severischen Zeitabschnitt stieg der
Importanteil in Veľký Meder sogar auf 25 % und in Bratislava-Trnávka umgekehrt
senkte er auf lediglich 9 %. Bei den Lieferungen der pannonischen Keramik nach Veľký Meder haben
sich höchstwahrscheinlich auch die Händler aus der Umgebung des nächsten Limeskastells
Ad Statuas auf dem südlichen, heute ungarischen, Donauufer beteiligt. Davon
zeugen fast werkstattidentische Bruchstücke der grauen pannonischen gestempelten Gefäße aus dem Römerlager einerseits und aus der germanischen Siedlung andererseits.
Auch die
Siedlungsagglomeration von Bratislava-Trnávka ist nur 7-8 Kilometer von der
Donaugrenze entfernt und die Importanteile erreichten nur die Halbwerte. Zum
Beispiel im 2. Jh. nahm der Importanteil in Bratislava-Trnávka 12 % vom gesamten Töpferware aus der Ansiedlung
und in Veľký Meder war das fast 20 %. Im severischen Zeitabschnitt stieg der
Importanteil in Veľký Meder sogar auf 25 % und in Bratislava-Trnávka umgekehrt
senkte er auf lediglich 9 %. Bei den Lieferungen der pannonischen Keramik nach Veľký Meder haben
sich höchstwahrscheinlich auch die Händler aus der Umgebung des nächsten Limeskastells
Ad Statuas auf dem südlichen, heute ungarischen, Donauufer beteiligt. Davon
zeugen fast werkstattidentische Bruchstücke der grauen pannonischen gestempelten Gefäße aus dem Römerlager einerseits und aus der germanischen Siedlung andererseits.  Bemerkenswert
sind auch die ganzen Sätze von den gleichen Gefäßformen, die in Fundkomplexen aus den Grubenhäusern vorgekommen sind. Obwohl sie in den Einfüllungen der eingetieften Hütten nur als zerbrochener Abfall auftraten, erwecken sie einen Eindruck, als
ob sie ursprünglich für die weitere Distribution bestimmt waren. Nicht uninteressant ist auch der nähere Blick auf die Struktur der importierten Keramik. Die germanischen Ansiedler
haben nicht das ganze Spektrum der pannonischen Töpferproduktion eingeführt, sondern nur die ausgewählten Gefäßformen. Eingekauft wurde vor allem die feinere Tisch- und Trinkware, vertreten
durch Tassen, Becher, Teller, Schüsseln und Krüge. Die in der Küche benutzten Töpfe mit Deckel und Vorratsgefäße sind auf dem nördlichen Donauufer nicht so zahlreich. Es scheint, dass die Germanen besorgten
sich aus dem römischen Gebiet vor allem Gefäße, mit denen sie sich beim Tisch rühmten. Bei den Töpfen aus der Küche sind sie auch mit eigener Produktion ausgekommen.
Bemerkenswert
sind auch die ganzen Sätze von den gleichen Gefäßformen, die in Fundkomplexen aus den Grubenhäusern vorgekommen sind. Obwohl sie in den Einfüllungen der eingetieften Hütten nur als zerbrochener Abfall auftraten, erwecken sie einen Eindruck, als
ob sie ursprünglich für die weitere Distribution bestimmt waren. Nicht uninteressant ist auch der nähere Blick auf die Struktur der importierten Keramik. Die germanischen Ansiedler
haben nicht das ganze Spektrum der pannonischen Töpferproduktion eingeführt, sondern nur die ausgewählten Gefäßformen. Eingekauft wurde vor allem die feinere Tisch- und Trinkware, vertreten
durch Tassen, Becher, Teller, Schüsseln und Krüge. Die in der Küche benutzten Töpfe mit Deckel und Vorratsgefäße sind auf dem nördlichen Donauufer nicht so zahlreich. Es scheint, dass die Germanen besorgten
sich aus dem römischen Gebiet vor allem Gefäße, mit denen sie sich beim Tisch rühmten. Bei den Töpfen aus der Küche sind sie auch mit eigener Produktion ausgekommen.
 In Veľký Meder wurden auch einige außergewöhnliche Importgegenstände
gefunden, wie z. B. Fragment einer männlichen Bronzestatuette (wahrscheinlich Merkur) (Meder_Bild_006 hier). Überwiegende Mehrzahl stellten jedoch übliche und billige römische Erzeugnisse dar, die für die breiten Bevölkerungsschichten zugänglich waren. Das eingeführte Spektrum unterscheidet sich auf den ersten Blick von den, für die barbarische Nobilität bestimmten römischen Luxusgütern, die in den reichen Fürstengräbern vorzufinden sind. Obwohl wir in der germanischen Siedlung auch auf die teueren
Glas- oder Terra sigillata-Gefäße stiessen, viel zahlreicher treten geläufige pannonische Tongefäße
auf. Die mächtige Importwelle kulminiert in Veľký Meder während der severischen
Zeit. Trotz seiner Intensität hinterließ der Strom der Importware in dieser
Siedlung keine nennenswerten Spuren, die zum deutlichen Wandel der Lebensbedingungen oder zur
Romanisation der Gesellschaft im engeren Sinne führen würden. Der römische Einfluss erreichte nur das Niveau der zugeführten Produkte. Die Lebensverhältnisse, mindestens nach Aussage der archäologischen Quellen, blieben unveränderte. Weiterhin wurden dieselben traditionellen Getreidearten angebaut und
weiterhin wohnte man in dieselben traditionellen Bauten. Die Holz-Erde-Bauten
standen hier im Kontrast zu der hoch entwickelter Steinarchitektur aus dem
gegenseitigen Donauufer. Ganz anders äußerte sich der römische Einfluss in den Kreisen der barbarischen Nobilität. Die germanischen Fürstenfamilien ließen sich seit dieser Zeit die Residenzen im römischen Stil zu bauen, wie das beispielhart der Steinbau aus Bratislava-Dúbravka dokumentiert.
In Veľký Meder wurden auch einige außergewöhnliche Importgegenstände
gefunden, wie z. B. Fragment einer männlichen Bronzestatuette (wahrscheinlich Merkur) (Meder_Bild_006 hier). Überwiegende Mehrzahl stellten jedoch übliche und billige römische Erzeugnisse dar, die für die breiten Bevölkerungsschichten zugänglich waren. Das eingeführte Spektrum unterscheidet sich auf den ersten Blick von den, für die barbarische Nobilität bestimmten römischen Luxusgütern, die in den reichen Fürstengräbern vorzufinden sind. Obwohl wir in der germanischen Siedlung auch auf die teueren
Glas- oder Terra sigillata-Gefäße stiessen, viel zahlreicher treten geläufige pannonische Tongefäße
auf. Die mächtige Importwelle kulminiert in Veľký Meder während der severischen
Zeit. Trotz seiner Intensität hinterließ der Strom der Importware in dieser
Siedlung keine nennenswerten Spuren, die zum deutlichen Wandel der Lebensbedingungen oder zur
Romanisation der Gesellschaft im engeren Sinne führen würden. Der römische Einfluss erreichte nur das Niveau der zugeführten Produkte. Die Lebensverhältnisse, mindestens nach Aussage der archäologischen Quellen, blieben unveränderte. Weiterhin wurden dieselben traditionellen Getreidearten angebaut und
weiterhin wohnte man in dieselben traditionellen Bauten. Die Holz-Erde-Bauten
standen hier im Kontrast zu der hoch entwickelter Steinarchitektur aus dem
gegenseitigen Donauufer. Ganz anders äußerte sich der römische Einfluss in den Kreisen der barbarischen Nobilität. Die germanischen Fürstenfamilien ließen sich seit dieser Zeit die Residenzen im römischen Stil zu bauen, wie das beispielhart der Steinbau aus Bratislava-Dúbravka dokumentiert.
Vladimír Varsik
Literatur:
Gabler, D et al.: The Roman Fort at Ács-Vaspuszta (Hungary) on the Danubian limes. BAR, Int. Ser. 531. Oxford 1989.
Varsik, V.: Veľký Meder und Bratislava-Trnávka: zwei germanische Siedlungen im Vorfeld des pannonischen Limes (Befunde und Chronologie: eine Übersicht). In: Stadt und Landschaft in der Antike. Anodos - Suppl. 3, Trnava 2003, 153-196.
Varsik, V.: Zur Entwicklung der quadischen Siedlung von Veľký Meder (SW-Slowakei). Študijné Zvesti Arch. Ústavu 36, 2004, 257-275.
Varsik, V.: Die kaiserzeitlichen Siedlungen im pannonischen Vorfeld (Slowakei) im Lichte des keramischen Importes. In: Proceedings of the 19th Congress of Roman Frontier Studies in Pécs Hungary 2003. Pécs im Druck.
.