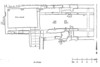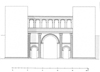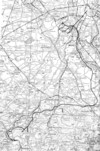Zentralorte im Süden der Provinz Niedergermanien
Politische Strukturen vor den Römern
Aus dem südlichen, heute deutschen Anteil der Provinz Niedergermanien kennen wir zwei Kolonien mit einem Stadtrecht: die colonia Claudia Ara Agrippinensium(CCAA) in Köln und die colonia Ulpia Traiana (CUT) in Xanten. Zu diesen Städten gehörte jeweils ein Territorium.
Einheimische Stämme konnten in Gebietskörperschaften (civitates) organisiert werden. So lässt sich als Vorgänger der CCAA-Köln das oppidum Ubiorum als Zentralort der hier von den Römern angesiedelten germanischen Ubier nachweisen, die bereits in der ersten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. eine Civitas bildeten. Dagegen scheint sich als Vorgänger der CUT-Xanten keine Gebietskörperschaft der ebenfalls von den Römern in diesem Raum angesiedelten Cugernern gebildet zu haben.
Die CCAA-Köln war zusätzlich auch Hauptstadt der um 85 n. Chr. gegründeten Provinz Niedergermanien. Schon ab dem frühen 1. Jh. n. Chr. besaß die Siedlung eine überregionale Funktion bei der Ausübung des Kaiserkultes.
Vor der Gründung der Kolonien waren die Gebiete als Stammesterritorien bzw. die Zugehörigkeit des westlich und südlich der Maas beheimateten Stammes der Tungrer zur Provinz Germania inferior oder zur Provinz Gallia Belgica ist umstritten. Der civitas Tungrorum mit dem Hauptort Atuatuca Tungrorum-Tongeren wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt der höhere Status eines Municipium verliehen. Sie wird im Folgenden nicht berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich zusammen mit dem auf niederländischem Gebiet gelegenen nördlichen Teil der Provinz, der die Gebietskörperschaften der Cannanifaten, Bataver und wohl auch der Frisiavonen umfasste eine Anzahl von 4 bis 6 Gemeinwesen für die gesamte Provinz.
Einheimische Vorläufer
Weder in Köln noch in Xanten lassen sich einheimische Vorgängersiedlungen nachweisen. Baustrukturen, wie sie bei einer solchen Siedlung zu erwarten wären, fehlen jeweils. Dies gilt auch trotz der Stammesbezeichnung im Ortsnamen des oppidum Ubiorum als Vorgängersiedlung der CCAA-Köln. Aus dem Bereich der späteren CUT-Xanten lassen zumindest Gräber und Funde germanischer Herkunft auf einen entsprechenden Bevölkerungsanteil schließen.
Gründung der Zentralorte
Die colonia Claudia Ara Agrippinensium(CCAA)-Köln wurde um 50 n. Chr. gegründet. Bis zur Koloniegründung trug die Siedlung den Namen oppidum Ubiorum, der bereits eine mögliche zentralörtliche Funktion nahe legt. Der Siedlungsbeginn lässt sich auf das erste Jahrzehnt n. Chr. datieren. In seiner Umgebung befand sich ein römisches Doppellegionslager. Einheimische Bauformen sind bislang nicht nachgewiesen, vielmehr handelte es sich wohl um eine nach römischen Grundsätzen ausgebaute Siedlung.
Anders stellt sich die Situation in der um 100 n. Chr. gegründeten colonia Ulpia Traiana (CUT)-Xanten dar. Eine dem oppidum Ubiorum vergleichbare Vorgängersiedlung ist nicht nachweisbar, vielmehr lassen sich auf dem Areal der späteren Kolonie Reste mehrerer Auxiliarkastelle mit zugehöriger Zivilsiedlung nachweisen. Ein älterer Zentralort der Cugerner ist an dieser Stelle unwahrscheinlich.
Bauphasen
In der CCAA-Köln lassen sich Steinbauten bereits vor der Gründung der Kolonie nachweisen. So datiert der als Ubiermonument bezeichnete Turm um 4 n. Chr. Der bereits in Stein ausgeführte Vorgängerbau des Prätoriums datiert ebenfalls in das frühe 1. Jh. n. Chr. Darüber hinaus lassen Fragmente von Baugliedern auf weitere Steinbauten schließen. Die Wohngebäude waren allerdings noch in Holzbauweise ausgeführt. Allerdings ist unser Bild von dieser Siedlung noch sehr fragmentarisch. Ob das spätere Straßennetz bereits bestand und in wieweit nach der Gründung der Kolonie noch ältere Strukturen Bestand hatten, ist weit gehend unklar. Es erfolgte jedenfalls eine Neubebauung, bei der nun auch die Wohnbauten in Stein bzw. mit Steinsockel und Fachwerkwänden ausgeführt wurden. Der Ausbau der Stadt mit öffentlichen Gebäuden und der Umwehrung erfolgte im Wesentlichen in der zweiten Hälfte des 1. Jh.
Die CUT-Xanten wurde im Zuge der Koloniegründung um 100 n. Chr. von Anfang an in Stein ausgebaut. Es entstanden Steinbauten bzw. Stein- oder auch Ziegelfundamente mit Holzfachwerk-Wänden. Die meisten öffentlichen Gebäude und die Stadtmauer datieren in die ersten Hälfte des 2. Jh. n. Chr.
Typische Bauten
Die Ausstattung mit öffentlichen Bauten erscheint für die beiden Kolonien im südlichen Niedergermanien vergleichbar. Wenn wir aus der CUT-Xanten mehr Großbauten kennen, so liegt dies in der größeren Fläche begründet, die dort archäologisch untersucht wurde. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass das Gelände der CCAA im Gegensatz zur CUT flächig überbaut ist. Mit dem Prätorium (Statthalterpalast) besitzt CCAA-Köln allerdings ein Gebäude, das mit seiner Funktion als Statthaltersitz zusammenhängt.
Forum und BasilikaAls öffentliches und wirtschaftliches Zentrum nahmen die Fora einen zentralen Platz am Schnittpunkt der Hauptstraßen in den Städten ein. Das nur in Ausschnitten nachgewiesene Forum in der CCAA-Köln wird an einer Seite von einer Basilika, an der anderen von einer monumentalen Kryptoportikus von 135 m Durchmesser abgeschlossen. Dies ist ungewöhnlich, da die Fora meist über einen geraden Abschluss verfügen. Wohl auch aufgrund der Größenverhältnisse hat man hier den Standort der ara Ubiorum, eines aus der Literatur bekannten Altars für den Kaiserkult, geschlossen. Deshalb wird es teilweise auch als Provinzforum bezeichnet. Für einen Altar an dieser Stelle liegen jedoch keine eindeutigen Belege vor. Auch die Entstehungszeit des Forums ist unsicher.
 |
Die rechteckige Forumsanlage in der CUT-Xanten wurde ab ca. 130 n. Chr. erbaut. Die Bauarbeiten beanspruchten einen längeren Zeitraum, denn laut einer Inschrift lieferte die niedergermanischen Flotte noch im Jahr 160 n. Chr. Baumaterial für die Arbeiten. Das Forum wurde von einer großen Basilika (120 x 23 m) abgeschlossen. An den übrigen Seiten befanden sich. kleine Verkaufsräume (Tabernen).
Bäder
Öffentliche Bäder gehörten zur Grundausstattung der Städte. Sie waren meist mit sehr hochwertigen Materialien ausgestattet und reich verziert. Nach den Fora stellen sie die öffentlichen Bauten mit dem größten Flächenbedarf dar.
Die öffentlichen Thermen der CCAA-Köln befanden sich auf dem Gebiet zweier Gebäudeblocks. Der Grundriss des ausgegrabenen Gebäudeteils sowie die Bauphasen können bislang nicht rekonstruiert werden. Ein weiteres öffentliches Bad, von dem allerdings nur ein kleiner Ausschnitt bekannt ist, wird im Nordwesten der Stadt vermutet. Beide Anlagen entstanden in der zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr
Die als große Thermen (ca. 120 x 120 m) bezeichnete öffentliche Badeanlage in der CUT-Xanten wurde durch eine außergewöhnlich große Basilika betreten. Aufgrund der aufeinander folgenden Baderäume lässt sie sich dem Reihentyp zuordnen. Ein großer Hofbereich stand für sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Die Anlage wurde um 125 n. Chr. erbaut.
HerbergenHerbergen (mansiones) sind in jedem Zentralort zu erwarten. Sie können nicht immer leicht erkannt werden, da unterschiedliche Grundrisse üblich waren. Einen als Herberge interpretierten Bau kennen wir aus der CUT-Xanten. Es handelt sich um ein schmales Gebäude von 80 m Länge, in dem kleinere und größere Räume (12-60 m2) von einem Flur aus zugänglich waren. An diesen Bau schloss sich eine eigene Badeanlage an. Er entstand in der ersten Hälfte des 2. Jh. n. Chr.
TheaterWeder in der CCAA-Köln, noch in CUT-Xanten ist bislang ein Bühnentheater nachgewiesen. Dies kann sicherlich nicht bedeuten, dass weder die CCAA noch die CUT über solche Bauten verfügt haben könnten.
AmphitheaterAmphitheater dienten der Durchführung von Gladiatorenkämpfen und Tierhetzen. Charakteristisch ist ihre ovale Form mit einer Areana in der Mitte. Ein relativ großes Amphitheater, das ca. 10.000 Besuchern Platz bot, ist in der CUT-Xanten untersucht worden. Der Steinbau aus der zweiten Hälfte des 2. Jh. hatte einen hölzernen Vorgänger ersetzt. In der Mitte der Arena befanden sich Kellerräume. Dort war eine Hebebühne installiert, die als Aufzug für Tiere oder auch Gladiatoren diente.
Obwohl in der CCAA-Köln bislang kein Amphitheater nachgewiesen ist, wird man im Hinblick auf die Bedeutung der Stadt eine solche Anlage annehmen dürfen. Außerdem liegen aus dem Stadtgebiet bzw. der Umgebung Inschriften vor, die auf eine Anwesenheit von Gladiatoren schließen lassen.
TempelSowohl in der CCAA-Köln, als auch in der CUT-Xanten sind in zentraler Lage Tempelbauten entdeckt worden, die als Kapitolstempel, also den Staatsgöttern Iupiter, Iuno und Minerva geweiht waren. Es handelt sich jeweils um Podiumstempel, die innerhalb eines ummauerten Bezirks lagen und deren Innernraum gemäß der Anzahl der zu verehrenden Gottheiten dreigeteilt war. Der Kölner Kapitolstempel wurde im letzten Drittel des 1. Jh. errichtet.
In der CUT-Xanten ist ein weiterer in römischer Bautradition errichteter Tempel nachgewiesen, der aufgrund seiner Lage als Hafentempel bezeichnet wird. Eine Mauer umgab das Heiligutum. Es ist unklar, welche Gottheit verehrt wurde. Der mit einer Ringhalle versehene Bau (36 x 24 m) stand auf einem 3m hohen Podium und wird mit einer Gesamthöhe von 27 m rekonstruiert.
Zwei gallorömische Umgangstempel (ca. 29 x 18 m) , die wohl zu einem größeren Kultbezirk gehörten, sind an der westlichen Stadtmauer in der CCAA-Köln nachgewiesen. Hier könnte nach einer Inschrift Iupiter verehrt worden sein. Innerhalb eines Wohnblocks (insula 20) in CUT-Xanten befand sich ein gallorömischer Umgangstempel. Das Heiligtum war wohl den Aufanischen Matronen geweiht. Beide Anlagen entstanden wohl nicht vor der zweiten Hälfte des 2. Jh.
Aus der CCAA-Köln kennen wir zwei Mithrasheiligtümer. Eines lag südlich des Domes, das andere im Westen der Stadt. Kennzeichnend für diese Heiligtümer sind abgesenkte Kulträume mit seitlichen Podien als Sitzbänken und einem in diesen Fällen nicht mehr erhaltenen Kultbild an der Stirnseite.
StadtmauernBeide Kolonien waren von einer Stadtmauer umgeben. Sie wurde in der CCAA-Köln im letzten Drittel des 1. Jh. n. Chr., also einige Zeit nach der Gründung der Kolonie erbaut. Für die Vorgängersiedlung oppidum Ubiorum sind Abschnitte eines umgebenden Erdwalls nachgewiesen. Dagegen errichtete man in der CUT-Xanten die Mauer aufgrund von dendrochronologischen Datierungen von Pfählen, die das Fundament stützten, unmittelbar nach der Koloniegründung um 105/106. Beide Stadtmauern waren mit Toren und Türmen versehen. Inbesondere die Tore erfuhren noch spätere Umbauten. Beide Umwehrungen hatten ursprünglich repräsentativen Charakter, der den Status der Stadt hervorheben sollte. Teile der römischen Stadtmauer der CCAA-Köln sowie ein Turm sind noch erhalten.
Wasserleitungen
Die im 2. Jh. in die CCAA-Köln führende Wasserleitung aus der Eifel stellt mit einer Länge von knapp 100 km mit Zuleitungen eines der größten Bauwerke dieser Art in den Nordwestprovinzen des römischen Reiches dar. Sie war gemauert und verlief überwiegend unterirdisch, jedoch wurden sowohl zur Überwindung des Swistals als auch bei den letzten 8 km vor der Stadtmauer oberirdische Aquädukte benötigt. Eine ältere, um ca. 50 n. Chr. gebaute Wasserleitung hatte die Stadt aus dem südöstlichen Vorgebirge versorgt.
In vergleichbarer Bautechnik ausgeführt, jedoch mit einer Länge von 12 km wesentlich kürzer, war die Wasserleitung, die die CUT-Xanten versorgte. Auch hier wurde der letzte Abschnitt als Aquädukt ausgeführt.
Beide Kolonien verfügten über ein flächendeckendes System von Abwasserkanälen, das innerhalb bzw. unter den Straßen verlief.
Rechtsstatus der Städte
Sowohl die um 50 n. Chr. gegründete colonia Claudia Ara Agrippinensium-Köln als auch die um 100 n. Chr. gegründete colonia Ulpia Traiana-Xanten waren Veteranenkolonien. Es handelt sich um Städte mit einem schriftlich fixierten Stadtrecht. Voraussetzung für eine Teilnahme an der städtischen Selbstverwaltung war der Besitz des römischen Bürgerrechts, das in der Anfangszeit auf die neu angesiedelten Veteranen sowie Einheimische beschränkt war, denen es durch den Kaiser verliehen worden war. Letzteres galt für ehemalige Auxiliarsoldaten sowie einzelne Angehörige der Oberschicht. Ubier, die nicht das römische Bürgerrecht besaßen, lassen sich noch bis zum Ende des 1. Jh. nachweisen.
Zuvor dürfte zumindest auf dem Gebiet im Bereich der späteren CCAA-Köln eine Civitas, also ein Gemeinwesen mit Selbstverwaltung, allerdings ohne ein Stadtrecht, bestanden haben. Für die um die spätere CUT-Xanten siedelnden Cugerner ist bislang allerdings nicht zu belegen. Allgemein geht man davon aus, dass die Civitates bzw. Stämme der Ubier und Cugerner vollständig in diesen Gemeinwesen aufgingen. Ein Nebeneinander von Kolonie und Civitas kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wie das Beispiel der Helvetier in Obergermanien lehrt.
Hinweise auf die Bewohner
Wir besitzen insbesondere aus Köln und seiner Umgebung Hinweise auf Einwohner der CCAA-Köln. Zahlreiche Grabsteine und Weihinschriften nennen Namen. Darunter befinden sich auch Dekurionen, also Mitglieder des Stadtrats, aus deren Mitte die städtischen Beamten gewählt wurden. Sie gehörten der Oberschicht des Gemeinwesens an. Ohne einen entsprechenden Hinweis auf die Herkunft ist die Zuweisung einer Person schwierig. Wenige Bürger sind auch als Ritter in hohen Ämtern des römischen Reiches nachgewiesen.
Aufgrund des nur bruchstückhaft erhaltenen Steinmaterials aus der CUT-Xanten beschränkt sich die Kenntnis der Einwohner Xantens auf wenige Beispiele.
Kulte
Neben den oben genannten Tempeln ist insbesondere in Köln noch eine Vielzahl von Kulten durch Inschriften nachgewiesen. Dabei kommt aufgrund der Anzahl der gefundenen Monumente der Verehrung der einheimischen Muttergottheiten, den Matres und Matrones eine besondere Bedeutung zu. Daneben können aber auch griechisch-römische und östliche Gottheiten nachgewiesen werden.
Zusammenfassung
Im Süden der Provinz Germania inferior befanden sich mit der CCAA-Köln und der CUT-Xanten zwei Veteranenkolonien, die um 50 n. Chr. bzw. um 100 n. gegründet worden waren. Die Vorgängersiedlung der CCAA-Köln, das oppidum Ubiorum, trug schon Kennzeichen eines überregionalen Zentrums und könnte bereits die Funktion eines Zentralortes für den Stamm der Ubier erfüllt haben. Ähnliches lässt sich als Vorgänger der CUT-Xanten nicht ausmachen, vielmehr gingen der dortigen Kolonie wohl Auxiliarkastelle und ein Vicus voraus, deren Strukturen allerdings spätestens mit der Gründung der Kolonie abgerissen und einplaniert wurden.
Sowohl bei der CCAA-Köln auch bei der CUT-Xanten handelt es sich um Siedlungen mit rechteckigem Straßenraster und einer regelmäßigen Einteilung in Gebäudeblocks (insulae), wobei für die CCAA-Köln auch eine planmäßige Anlage der Vorgängersiedlung mit rechteckigem Straßenraster möglich erscheint. Die Siedlungsflächen betrugen 97 ha (Köln) bzw. 76 ha (Xanten). Große Teile des Stadtgebietes wurden von öffentlichen Bauten eingenommen. Ihre Funktion als Provinzhauptstadt spiegelt sich in der CCAA-Köln auch in dem als Statthalterpalast (Prätorium) interpretierten Bau wider. Beide Städte verfügten über aufwändige Stadtmauern. Während sich für die CUT-Xanten ein starkes Engagement staatlicher und militärischer Stellen aufgrund der Verwendung von militärischem Ziegelmaterial bei öffentlichen Bauprojekten zeigt, lässt sich dies abgesehen vom Prätorium in der CCAA-Köln nicht nachweisen. Monumentalität und Ausführung der Großbauten zeugen von einem hohen Standard, der vergleichbar ist mit den Kolonien im südlichen Obergermanien oder auch den gallischen Provinzen. Dies gilt auch für Fernwasserleitungen der Städte.
Die Wohnbauten innerhalb der Gebäudeblocks reichen von langrechteckigen Baukörpern mit gemeinsamen Außenwänden bis zu villenähnlichen Anlagen einer vermögenden Oberschicht, deren Anteil man für die CCAA-Köln wohl zahlreicher als für die CUT-Xanten annehmen muss. Dass wir wesentlich mehr städtische Magistrate aus Köln kennen, hängt jedoch auch mit dem systematischen nachantiken Steinraub in Xanten zusammen. Dort waren bei der Suche nach geeignetem Baumaterial auch die Mauern bis auf die Fundamente geplündert worden. Anklänge an einheimische Bautraditionen sind nicht bzw. nur in geringem Umfang feststellbar.
Beiden Städten gleich ist eine hervorragende Ausstattung mit öffentlichen Bauten, die keinen Vergleich mit anderen Kolonien in den Grenzprovinzen zu scheuen brauchten. Somit bildeten sie innerhalb der Provinz Niedergermanien die wichtigsten zivilen Zentren.
Thomas Schmidts
Literatur (Auswahl)
T. Bechert, Römisches Germanien zwischen Rhein und Maas. Die Provinz Germania inferior (München 1982).
W. Eck, Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen des Imperium Romanum. Geschichte der Stadt Köln 1 (Köln 2004).
H. Galsterer, Kolonisation im Rheinland. In: Cités, municipes, colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain (Paris 1999) 251-269.
M. Gechter, Das städtische Umland in Niedergermanien im 2. Jh. n. Chr. In: Die römische Stadt im 2. Jh. n. Chr. Xantener Berichte 2 (Köln/Bonn 1992), 153-161.
H. Hellenkemper, Architektur als Beitrag zur Geschichte der Colonia Ara Agrippinensium. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II.4, 1975, 783-824.
H. von Hesberg, Bauteile der frühen Kaiserzeit in Köln. Das Oppidum Ubiorum zur Zeit des Augustus. In: Festschrift Gundolf Precht. Xantener Berichte 13 (Mainz 2002) 13-36.
U. Heimberg/A. Rieche, Colonia Ulpia Traiana. Die römische Stadt. Planung, Architektur, Ausgrabung. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 18 (Köln 1998).
H. Hinz, Xanten zur Römerzeit. Kulturstätten am Niederrhein, 1 (Xanten5 1973).
H. Hinz, Colonia Ulpia Traiana. Die Entwicklung eines römischen Zentralortes am Niederrhein. I. Prinzipat. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II/4, 1975, 825-869.
H. G. Horn (Hrsg.), Die Römer in Nordrhein-Westfalen (Stuttgart 1987).
K. H. Lenz, Der antike Name des frühkaiserzeitlichen Siedlungsgefüges römischer Hilfstruppenlager und Lagervici im Areal der Colonia Ulpia Traiana (Xanten). Zu den Civitas-Hauptorten des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Niedergermanien. Archäologisches Korrespondenzblatt 33/3, 2003, 375-392.
B. Päffgen/W. Zanier, Überlegungen zur Lokalisierung von Oppidum Ubiorum und Legionslager im frühkaiserzeitlichen Köln. In: Provinzialrömische Forschungen. Festschrift Günter Ulbert (Espelkamp 1995) 111-129.
G. Precht, Baugeschichtliche Untersuchungen zum römischen Praetorium in Köln. Rheinische Ausgrabungen 14 (Köln, Bonn 1973).
G. Precht, Neue Befunde zur vorcoloniazeitlichen Siedlung. Die Grabungen an der Südostecke der Capitols- und Forumsinsula. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 6 (Mainz 2001) 37-56.
G. Precht, Konstruktion und Aufbau sogenannter römischer Streifenhäuser am Beispiel von Köln (CCAA) und Xanten (CUT). In: Haus und Siedlung in den römischen Nordwestprovinzen. Grabungsbefund, Architektur und Ausstattung (Homburg/Saar 2002) 181-198.
M. Th. Raepsaet-Charlier, Les instutitions municipals dans les Germanies sous le Haut Empire. In: Cités, municipes, colonies. Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain (Paris 1999) 271-352.
M. Th. Raepsaet-Charlier, Vielfalt und kultureller Reichtum in den civitates Niedergermaniens. Bonner Jahrbücher 202/203, 2002/2003, 35-56.
A. Rieche, Führer durch den Archäologischen Park Xanten. Führer und Schriften des Archäologischen Parks Xanten 15 (Köln 1994).
Ch. B. Rüger. Germania inferior. Untersuchungen zur Territorial- und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatszeit. Beihefte Bonner Jahrbücher 30 (Köln, Graz 1968).
H.-J. Schalles, Städte im Rheinland: das Beispiel Xanten. In: Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer. Ausstellungskatalog Rosenheim (Mainz 2000) 104-107.
H.-J. Schalles, Überlegungen zur Planung der Colonia Ulpia Traiana und ihrer öffentlichen Bauten im Spiegel städtischer Architektur des 2. Jahrhunderts n. Chr. In: Genese, Struktur und Entwicklung römischer Städte. Xantener Berichte 6 (Köln 1995) 379-428.
R. Thomas, Bodendenkmäler in Köln. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 32, 1999, 917-965.
F. Vittinghoff, Die politische Organisation der römischen Rheingebiete in der Kaiserzeit. In: Civitas Romana. Stadt und politisch-solziale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit (Stuttgart 1994) 66-88 (Abdruck eines Beitrages von 1976).